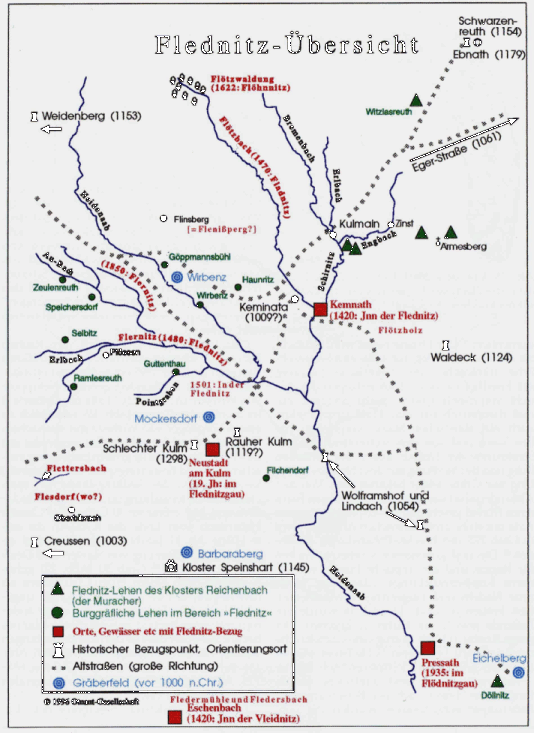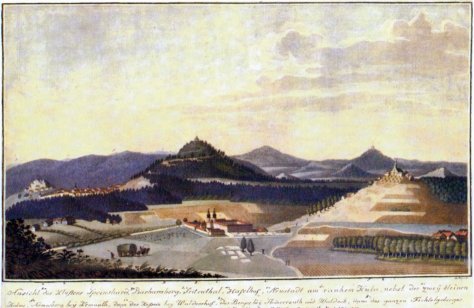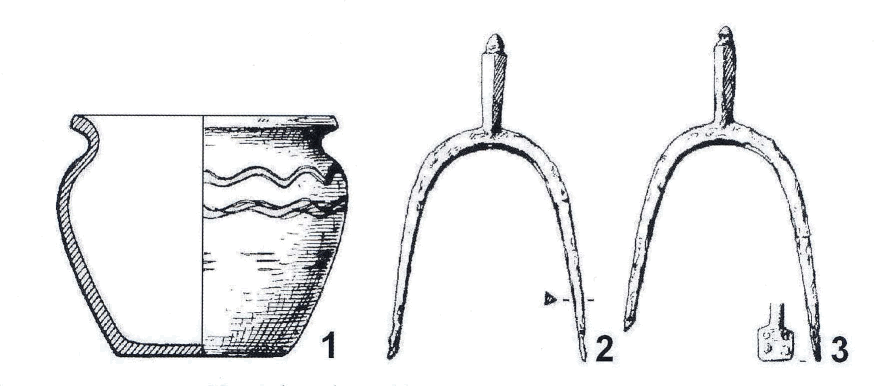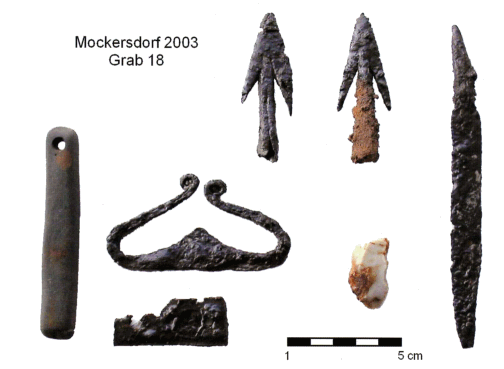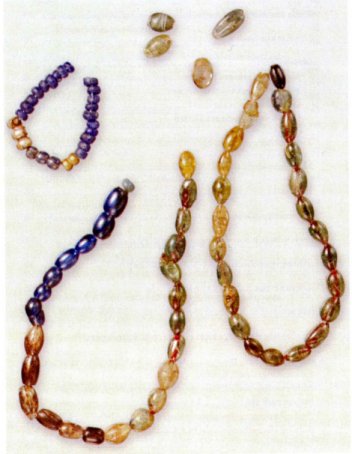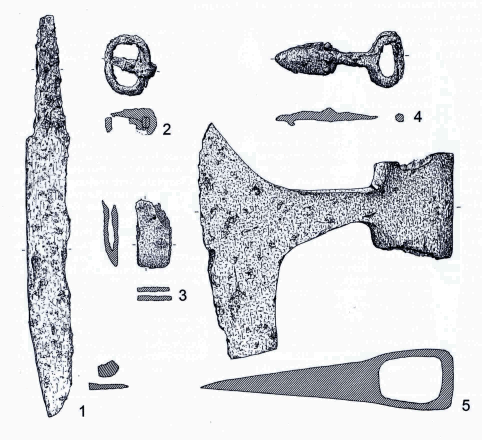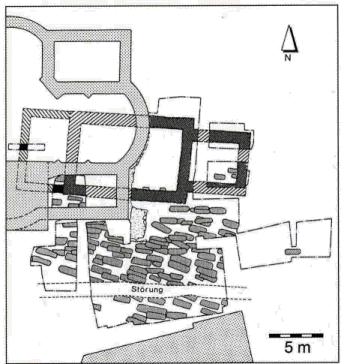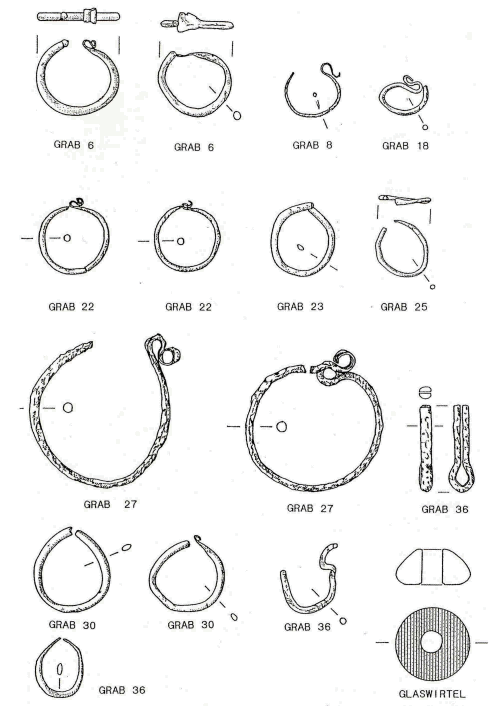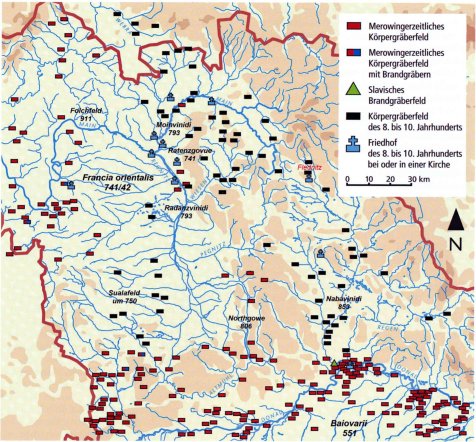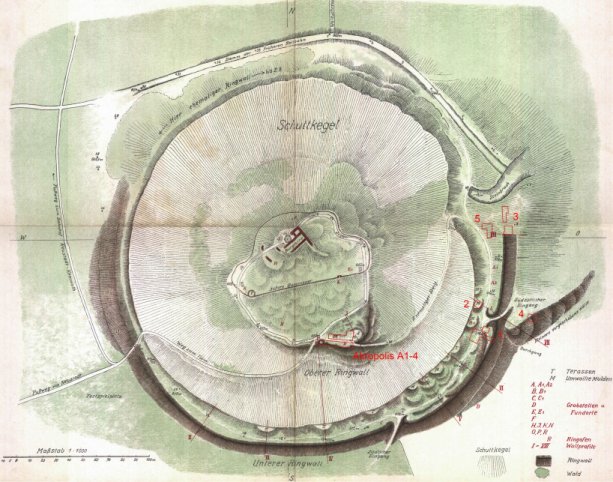|
Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm
in der Flednitz (Hans Losert): 2. Teil
In den
vergangenen Jahren fanden in der Flednitz, der slawischen
bzw. naabwendischen Siedlungskammer, deren natürliches Zentrum der Rauhe
Kulm bildet, eine Reihe archäologischer Untersuchungen statt, die unsere
Kenntnisse von der früh- und hochmittelalterlichen Siedlungsgeschichte
im Einzugsbereich der Haidenaab beträchtlich erweiterten.
[Frühmittelalterliche Friedhöfe]
Schon
seit den 1880er Jahren wurden auf einem Höhenrücken in der Flur
Marteranger bei Eichelberg 14 km südöstlich vom Rauhen Kulm immer wieder
Gräber beobachtet. (35) Eine genauere
Dokumentation dieser Nekropole des 8./9. Jahrhunderts zwischen den
Altstraßen von Eichelberg nach Altendorf und Pressath wäre sehr
wünschenswert, zumal von hier ein Grab mit Sporen (Abb. 18; 1-2), also
der Hinweis auf einen Berittenen sowie die Beigabe in Form eines
Tongefäßes mit Wellenbanddekor (Abb. 18; 3) - letzteres Beleg für
verhältnismäßig frühe Zeitstellung - vorliegen.
2003
und 2004 wurden in der seit 1921 bekannten Nekropole auf dem Bühl
bei Mockersdorf am Fuße des Rauhen Kulms noch einmal 40
frühmittelalterliche Bestattungen dokumentiert. (36)
Der Ortsname ist wohl deutsch, als eindeutiger Beleg für eine
karolingerzeitliche fränkische oder bayerische Siedlung mit Friedhof ist
dies jedoch entgegen der Ansicht von Adolf Gütter (37)
nicht geeignet, zumal theoretisch für den Platz ursprünglich auch ein
slawischer Name vorgelegen haben kann und von den frühmittelalterlichen
Strukturen der Flednitz außer der zentralen Burg und der Siedlung auf
dem Netzaberg bislang nur Gräberfelder bekannt sind. Von den Altfunden
sind vor allem ein Beschlag in Form eines frontal gesehenen Tierkopfes
sowie zwei Äxte mit einer großmährischen Analogie etwa in Grab 375 von
Bfeclav-Pohansko zu erwähnen. (38) Die neu
geborgenen Gräber enthielten für Region und Zeit typische Funde, wie
silberne Kopfschmuckringe, Glasperlen, bronzene Nadeln und Fingerringe
sowie Messer. Den Frauen in Grab 12 und 14 wurde am Fußende jeweils ein
Huhn mitgegeben. Der junge Knabe in Grab 18 trug eine Gürteltasche mit
Feuerstahl, Feuerstein, Schleifstein, Messer und zwei geflügelten
Pfeilspitzen (Abb. 19).
[Angst vor Wiedergängern?]
Außergewöhnlich sind zahlreiche Bestattungen, bei denen nach der
Beisetzung Veränderungen vorgenommen wurden, die wohl im weitesten Sinne
mit symbolischer Bannung des Toten bzw. Angst vor Wiedergängern bzw.
Untoten zu tun haben. So wurde bei fast allen Skeletten der Schädel
sekundär verlagert. In Grab 6 wurde er auf dem entnommenen Unterarm
aufgespießt, in Grab 4 unter einem fast die ganze Grubenbreite
einnehmenden Sandstein zerdrückt. Da die übrigen Knochen dabei nicht
bewegt wurden, geschah dies, als kein Sehnenverband mehr bestand, die
Verwesung des Leichnams also weitgehend abgeschlossen war. Besonders
eindrucksvoll ist Grab 22, wo der Körper der Toten nach Verlagerung des
Kopfes mit zahlreichen großen Sandsteinbrocken bedeckt wurde (Abb. 20).
Wenigstens zwei Personen wurden auf dem Bauch liegend beerdigt.
Vergleichbare Praktiken sind für die benachbarte Nekropole von
Eichelberg, aber auch für das Gräberfeld von Matzhausen im
Truppenübungsplatz Schmidmühlen überliefert. (39)
Inwieweit diese bei den Westslawen nicht seltenen Erscheinungen (40) Zeugnisse von Heidentum oder Synkretismus sind, ist
kaum zu beurteilen.
[Die Nekropole
von Wirbenz]
Nur
knapp 6 km nordöstlich vom Rauhen Kulm, aber schon im oberfränkischen
Landkreis Bayreuth liegt die 1995 entdeckte und offenbar vom 8. bis 10.
Jahrhundert genutzte Nekropole von Wirbenz (Abb. 21-22). (41)
Falls das Gräberfeld im Norden der Flednitz (Abb. 16), tatsächlich zu
einem Vorgänger von Wirbenz mit slawischem Ortsnamen (42)
gehört, würde dies wegen der mit mehr als 500 m auffällig großen
Entfernung zwischen Dorf und Bestattungsplatz für strukturelle
Veränderungen der Siedlungslandschaft sprechen. Die Untersuchung in der
Flur Kalkäcker 1996 und 1997 erbrachte 30 Gräber, die Claudia Haberstroh
vom Ende des 8. bis in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts datiert und
einer Mischbevölkerung von Slawen und Deutschen zuschreibt. (43)
Grab 30 (Abb. 22) gehöre jedoch nach einem Hiatus
frühestens an den Beginn des 11. Jahrhunderts. Die ungewöhnlich späte
Einordnung des unter anderem mit einer Bartaxt ausgestatteten Mannes
beruht auf einer der für die fünf Bestattungen 9 (Frau, 785-895), 10
(junge Frau, 685-805, Abb. 19), 16 (Frau, 934-1032, Abb. 19), 17 (Frau,
685-775, Abb. 19) und 30 (998-1122) vorliegenden Radiokarbonanalysen.
(44)
[Der Friedhof
vom Barbaraberg]
Die
jüngste bekannte Nekropole der Flednitz, die noch in die Zeit vor
einer festen Pfarreiorganisation gehört, wurde schon 1972 entdeckt und
liegt auf dem Barbaraberg beim Kloster Speinshart 4 km südlich vom
Rauhen Kulm (Abb. 2S-24). (45) Daß der Gipfel des
Rauhen Kulms von diesem Bestattungplatz aus gesehen ganz genau die
Himmelsrichtung Nord angibt, ist sicher kein Zufall. Bei den 1992 bis
1995 von Anja Heidenreich durchgeführten Ausgrabungen wurden 161 Gräber
mit 297 Individuen dokumentiert. Echte Beigaben kamen dort nicht mehr in
die Gräber, erhaltene Trachtbestandteile sind fast allein Schläfenringe
mit guten Analogien in Böhmen, Thüringen und Westungarn. (46)
Bemerkenswert ist, dass Olav Röhrer-Ertl bei der anthropologischen
Untersuchung der Skelette deutliche Bezüge zum pannonischen Raum
feststellte und die auf dem Barbaraberg Bestatteten einer sozial
gehobenen Schicht zuschrieb. (47) Am Nordrand der
Nekropole wurde dann wohl um 1000 eine Steinkirche errichtet. Der Saal
mit Rechteckchor und westlicher Erweiterung (Abb. 23) war wohl auch
Eigenkirche regionalen slawischen Adels, obwohl von der zugehörigen
Siedlung, der sagenhaften Mirga, bislang keine Spuren angetroffen
wurden. Der in Schriftquellen des hohen Mittelalters nicht überlieferte
Bau - die einzige bekannte von den sicher ursprünglich in größerer
Anzahl vorhandenen Missionskirchen der mittleren und nördlichen
Oberpfalz - übernahm in der Flednitz vor Einsetzen einer
flächendeckenden Kirchenorganisation durch Pfarreien letzteren ähnelnde
Funktionen.
2006
wurden Reste vorgeschichtlicher und mittelalterlicher Strukturen auf dem
Netzaberg bei Eschenbach nachgewiesen. (48) Es handelt sich bislang um
die einzige archäologisch untersuchte Siedlung der Flednitz, die
bis in das frühe Mittelalter zurückreicht. Die wenigen Keramikscherben
der Zeit vor 1000 haben direkte Analogien unter den Funden vom Rauhen
Kulm.
[Kontakte zwischen Bajuwaren und Slawen]
Der
archäologische Forschungsstand zu Slawen, Bajuwaren und Ostfranken in
der nördlichen Oberpfalz um Kemnath hat sich durch Grabungen der letzten
Jahre deutlich verbessert, (49) dennoch bleiben viele Fragen offen,
besonders dann, wenn eindeutige Antworten erwartet werden. Die Oberpfalz
nördlich der Donau war ebenso wie die Gebiete an Main und Regnitz
vielschichtigen Prozessen ausgesetzt, an denen Bajuwaren, Franken,
Thüringer, Slawen und als wichtiger Traditionsträger die namenlose
autochthone Bevölkerung beteiligt waren. Das frühslawische
Brandgräberfeld von Mockersdorf 2003 Grab 18
Regensburg-Großprüfening
(50) zeigt, dass es seit dem letzten Drittel des
6. Jahrhunderts zu engeren Kontakten zwischen Bajuwaren und Slawen kam,
die schließlich mit Duldung des agilofingischen Herzogs und wohl auch
der merowingischen Könige die Ausbreitung slawischer Kultur über das
Naabtal nach Norden ermöglichte. Erkennbar ist dann anhand
archäologischer Funde und Siedlungsnamen ein verhältnismäßig
geschlossenes naabwendisches Siedlungsgebiet mit der Flednitz im
Norden (Abb. 25), das nach Böhmen durch den Oberpfälzer und Bayerischen
Wald und nach Westen durch die Oberpfälzer Alb begrenzt wird.
Kennzeichnend für diese Region sind bedeutende Verkehrspforten
gleichermaßen zu den germanischen wie slawischen Nachbarn. Im Norden und
Nordwesten bestand über die Weidener Bucht bzw. Flednitz und über
die Wiesent eine Verbindung zum main- bzw. regnitzwendischen Bereich; im
Osten führten bedeutende Wege nach Böhmen.
Die
seit um 700 faßbare Übernahme von Körperbestattungen durch die
Naabwenden ist Folge der von West nach Ost getragenen kulturellen
Umformungsprozesse, die mit der Ausbreitung und Verfestigung politischer
und kirchlicher Strukturen an der Peripherie des Frankenreiches
einherging. Die dynamischen Transformations- und kulturellen
Ausgleichsprozesse erfaßten wenig später auch die slawischen Nachbarn im
Osten und Südosten. Anders als dort kam es im Bearbeitungsgebiet jedoch
allmählich zur Assimilation der slawischen Bevölkerung, die im Verlaufe
des hohen und späten [?] Mittelalters zum Verlust der eigenen Sprache
führte. Aus Naabwenden wurden die einen bayerischen Dialekt sprechenden
Oberpfälzer. Eine wichtige noch zu klärende Frage bezüglich der
zeitlichen Abfolge und herrschaftlichen Zuordnung des Landesausbaus
betrifft das Verhältnis der Flednitz zur regio Egere. Die
Erforschung der vielschichtigen historischen Prozesse in einer Grenz-
und Kontaktzone zwischen germanischer und slawischer Siedlung bzw.
Kultur bleibt spannend.
(34) Die
archäologischen Untersuchungen am Rauhen Kulm wären ohne die großzügige
Unterstützung durch viele historisch interessierte Personen und
zahlreiche örtliche und überregionale Institutionen nicht möglich
gewesen. Allen Helfern und Gönnern gilt an dieser Stelle unser
herzlicher Dank. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die
Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis,
die im Rahmen ihres von der Europäischen Union geförderten
grenzübergreifenden Projektes „Siedlung - Sprache - Straße.
Siedlungsgeschichte in der Euergio Egrensis" die Grabung am Rauhen Kulm
überhaupt erst möglich gemacht hat.
(35) Pöllath 2002: 123-124, Taf. 20; 1-4, Taf. 117; 2, Stroh 1954: 25,
Taf. 17; E, Taf. 21; C
(36) Losert 2006: 54-55, Losert & Szameit 2004.
(37) Gütter 1997: 137.
(38) Stroh 1954: Taf. 15; B10, 24-25, Kalousek 1971: 203, Abb. 375; 3.
(39) Stroh 1954: 25, 29-33, Taf. 19; A.
(40) Brather 2001: 264, Röhrer-Ertl 1999: 54-58, Siupecki 2000.
(41) Haberstroh, C. 2004, 2007, Krebs 1998.
(42) Eichler, Greule, Janka & Schuh 2006: 236-239, 251, 257, 263, 265.
(43) Haberstroh, C. 2004: 89-93.
(44) Haberstroh, J. 2004.
(45) Heidenreich 1997, 1998, Röhrer-Ertl 1998, Röhrer-Ertl
1999:25-97.
(46) Heidenreich 1998: 41-53, 77-78.
(47) Röhrer-Ertl 1998: 158-167, Röhrer-Ertl 1999: 71-80.
(48) Raßhofer 2007: Abb. 8; 2-6, Eiser & Losert 2007, die Endpublikation
durch Eiser & Losert ist im Druck.
(49) Vergleiche Losert 2003c und besonders Tovornik 1988: 126-127.
(50) Eichinger & Losert 2004.
Literatur
- Abels, Björn-Uwe und Losert, Hans 1986: Eine frühmittelalterliche
Befestigungsanlage in Laineck, Stadt Bayreuth. Bayerische
Vorgeschichtsblätter. Jahrgang 51: 285-308. München.
- Brather, Sebastian 2001: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung,
Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen
Ostmitteleuropa. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde. Band 30. Berlin, New York.
- Dollacker, Anton 1938: Altstraßen der mittleren Oberpfalz.
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg. 88.
Band: 167-186. Regensburg.
- Eichinger, Wolfgang und Losert, Hans 2004: Ein merowingerzeitliches
Brandgräberfeld östlich-donauländischer Prägung bei Großprüfening, Stadt
Regensburg, Oberpfalz. Das archäologische Jahr in Bayern 2003: 98-101.
Stuttgart.
- Eichler, Ernst; Greule, Albrecht; Janka, Wolfgang und Schuh, Robert
2006: Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung. Band 2.
Siedlungsnamen im oberfränkischen Stadt- und Landkreis Bayreuth. Slavica.
Monographien, Hand-, Lehr und Wörterbücher. Band 4. Heidelberg.
- Eiser, Anja und Losert, Hans 2007: Ländliche Siedlungen der
Vorgeschichte und des frühen bis hohen Mittelalters auf dem Netzaberg.
Gemeinde Eschenbach, Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, Oberpfalz. Das
archäologische Jahr in Bayern 2006: 134-136. Stuttgart.
- Emmerich, Werner 1955: Das Haupt Wegenetz des 11. Jahrhunderts in den
oberen Mainlanden und seine Grundlagen in karolingischer Zeit. Jahrbuch
für fränkische Landesforschung 15: 255-283. Kallmünz-Opf.
- Ettel, Peter 2001: Karlburg - Roßtal - Oberammerthal. Studien zum
frühmittelalterlichen Burgenbau in Nordbayern. Grabungen des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege K. Schwarz, R. Koch, L. Wamser.
Veröffentlichung der Kommission zur vergleichenden Archäologie römischer
Alpen- und Donauländer der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie. Materialien und
Forschungen. Band 5. Rhaden/Westf.
- Fähnrich, Harald 1994: Der Rauhe Kulm - Berg der Riesen und Schätze.
Aus dem Schönwerth-Nachlaß (um 1865). Heimat Eschenbach 1994: 24-28.
Eschenbach.
- Gerlach, Thomas 2008: Die Stadt auf dem Berge. Archäologie in
Deutschland 1/2008: 68-69. Stuttgart.
- Gerlach, Thomas und Simon, Klaus 1989: Zur archäologischen Topographie
des Löbauer Schafberges. Ausgrabungen und Funde. Band 34: 22-26. Berlin.
- Gradl, Heinrich (Hrsg.) 1886: Monumenta Egrana. Denkmäler des
Egerlandes als Quellen für dessen Geschichte. I. Band (805-1322). Eger.
- Gütter, Adolf 1997: „Neustadt am Kulm", „Mockersdorf" und „Filchendorf".
Archiv für Geschichte von Oberfranken. 77. Band: 133-139. Bayreuth.
- Guttenberg, Erich Freiherr von 1927: Die Territorienbildung am
Obermain. Neunundsiebzigster Bericht des Historischen Vereins für die
Pflege der Geschichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg zu Bamberg
1925-26:1-XVII, 1-539. Bamberg.
- Haberstroh, Claudia 2004: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von
Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. Kataloge der Archäologischen
Staatssammlung München. Nummer 30. München.
- Haberstroh, Claudia 2007: Das frühmittelalterliche Gräberfeld bei
Wirbenz. In: Gemeinde Speichersdorf (Hrsg.): 41-46.
- Haberstroh, Jochen 2004: Radiokarbonanalysen am Skelettmaterial
frühmittelalterlicher Grabfunde Oberfrankens. Zur Chronologie des 7. bis
11. Jahrhunderts in Nordostbayern. In: Haberstroh, Claudia: 29-39.
- Häusler, Ines 2004: Der Beitrag des slavischen Siedlungsträgers zur
Raumerschließung in der Oberpfalz - eine historisch-geographische
Analyse. Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie und Raumplanung.
Band 9/2004:1-175. Kallmünz.
- Heidenreich, Anja 1997: Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem
Barbaraberg. Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab. Das
archäologische Jahr in Bayern 1996:152-155. Stuttgart.
- Heidenreich, Anja 1998: Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem
Barbaraberg im Landkreis Neustadt/Waldnaab. Mit einem anthropologischen
Anhang von Olav Röhrer-Ertl. Otnant-Gesellschaft für Geschichte und
Kultur in der Euregio Egrensis. Archäologische Zeugnisse zur
Siedlungsgeschichte. Band 1. Bamberg, Pressath.
- Hejna, Antonin 1967: Archeologicky Vyzkum a pocätky Sidlistniho vy
voje Chebu a Chebska (Eger, seine archäologische Durchforschung und die
Anfänge der Siedlungsentwicklung der Stadt, deutsche Zusammenfassung).
Pamätky Archeologicke. Band LVIII: 169-271. Prag.
- Hejna, Antonin 1968: Zur Problematik der slawischen Besiedlung von
Cheb (Eger) und des Egerlandes. Arbeits- und Forschungsberichte zur
sächsischen Bodendenkmalpflege. Band 18: 363-388.
Berlin.
- Hejna, Antonin 1971: Archeologicky Vyzkum a pocätky Sidlistniho vyvoje
Chebu a Chebska II. Die archäologische Forschung und ihre
Bedeutung für die Frage der Siedlungsentwicklung in Eger und dem
Egerlande im frühen und hohen Mittelalter II. Pamätky Archeologicke.
Band LXII: 488-555. Prag.
- Herrmann, Erwin 1965: Slawisch-germanische Beziehungen im
südostdeutschen
Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm. Ein Quellenbuch mit
Erläuterungen. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Band 17.
München.
- Jakob, Hans 1982: Zur Gentilaristokratie der Main- und Regnitzwenden.
Archiv für Geschichte von Oberfranken. 62. Band: 13-20. Bayreuth.
- Kalousek, Frantisek 1971: Bfeclav Pohansko. Velkomoravske pohfebiste u
kostela I (Großmährisches Gräberfeld bei der Kirche). Archeologicke
prameny z pohfebiste (Archäologische Quellen vom Gräberfeld). Opera Universitatis Purkynianae Brunensis Facultas
Philosophica 169. Brno.
- Koch, Ursula 1984: Der Runde Berg bei Urach V. Die Metallfunde der
frühgeschichtlichen Perioden aus den Plangrabungen 1967-1981.
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Kommission für Alamannische
Altertumskunde. Schriften Band 10. Heidelberg.
- Krebs, Claudia 1998: Ein karolingischer Friedhof bei Wirbenz. Gemeinde
Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Oberfranken. Das archäologische Jahr
in Bayern 1997: 146-149. Stuttgart.
- Kunstmann, Helmut 1965: Die Burgen der östlichen Fränkischen Schweiz.
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte Reihe IX.
Darstellungen aus der Fränkischen Geschichte. Band 20. Würzburg.
- Lickleder, Hermann 1995: Die Urkundenregesten des
Prämonstratenserklosters Speinshart 1163-1557. Speinshartensia. Beiträge
zur Geschichte des Prämonstratenserklosters Speinshart. Herausgegeben
von der Prämonstratenserabtei Speinshart. Band 1. Pressath.
- Losert, Hans 2003: Bajuwaren und Slawen im frühen Mittelalter in der
mittleren und nördlichen Oberpfalz. In: Stadt Sulzbach-Rosenberg
(Hrsg.): Sulzbach und das Land zwischen Naab und Vils im frühen
Mittelalter. Tagung vom 13. - 14. Juni 2002 in Sulzbach-Rosenberg. Band
19 der Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs
Sulzbach-Rosenberg: 155-162. Sulzbach.
- Losert, Hans 2006: Eine frühmittelalterliche Wüstung unbekannten
Namens bei Dietstätt. Gemeinde Schwarzach b. Nabburg, Oberpfalz. Das
frühmittelalterliche Gräberfeld von Mockersdorf. Stadt Neustadt a. Kulm,
Oberpfalz. Untersuchungen im Bereich des Ringwalls am Rauhen Kulm. Stadt
Neustadt a. Kulm, Oberpfalz. In: Ericsson, Ingolf und Kenzler, Hauke
(Hrsg.): Rückspiegel. Archäologie des Alltags in Mittelalter und früher
Neuzeit. Begleitheft zur Ausstellung des Lehrstuhls für Archäologie des
Mittelalters und der Neuzeit an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Historisches Museum Bamberg 29. 4 - 5.11. 2006: 43-44, 54-55, 60-61.
Bamberg.
- Losert, Hans 2007: Neue Forschungen am Rauhen Kulm. Teil 2:
Archäologische Untersuchungen zur Kenntnis von Besiedlung und
Befestigung im frühen Mittelalter. In: Chyträcek, Miloslav, Michälek,
Jan, Rind, Michael M. und Schmotz, Karl (Hrsg.): Archäologische
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Archeologickä
pracovni skupina vychodni Bavorsko/zäpadni a jifini Cechy. 16. Treffen
21. bis 24. Juni 2006 in Plzen-Kf imice: 119-126. Rahden/Westf.
- Losert, Hans und Szameit, Erik 2004: Archäologische Untersuchungen im
wieder entdeckten frühmittelalterlichen Gräberfeld von Mockersdorf.
Stadt Neustadt am Kulm, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Oberpfalz.
Das archäologische Jahr in Bayern 2003: 101-103. Stuttgart.
- Losert, Hans und Szameit, Erik 2005a: Der Rauhe Kulm in der nördlichen
Oberpfalz, Ausgrabungen am Naturdenkmal. Ausgrabungen in Deutschland.
Heft 2: 38. Stuttgart.
- Losert, Hans und Szameit, Erik 2005b: Ausgrabungen im Bereich der vor-
und frühgeschichtlichen Umwehrung am Rauhen Kulm. Stadt Neustadt am Kulm,
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Oberpfalz. Das archäologische Jahr in
Bayern 2004:126-128. Stuttgart.
- Manske, Dietrich Jürgen 2003: Jüngere Forschungen zur frühen
Besiedlung der Oberpfalz - Eine Zusammenschau archäologischer,
historischer sprachgeschichtlicher und kulturgeographischer
Forschungsergebnisse. Der Erdstall. Beiträge zur Erforschung künstlicher
Höhlen. Nr. 29: 5-19. Roding.
- Monumenta Boica 1823. Band XXV. München.
- Neischl, Adalbert 1912: Die vor- und frühgeschichtlichen Befestigungen
am Rauhen Kulm bei Neustadt a. Kulm (Oberpfalz). Nürnberg.
- Neubauer, Michael 2001: Die Göppmannsbühl-Karte von 1531. Die Euregio
Egrensis im Bild alter Landkarten. Serie 1: Älteste Blätter/Nr. 1.
Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis.
Selb.
- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 1995: Neue Aspekte zur
Siedlungsgeschichte des Landes um den Rauhen Kulm. Das Flednitzgebiet
und ein königlicher Villikationskomplex um Hausen? In: Fühl, Karl
(Hrsg.): 625 Jahre Neustadt am Kulm. Jubiläumsschrift der Stadt Neustadt
am Kulm und zum Bergfestspiel „Die Hochzeit am Rauhen Kulm": 66-83.
Neustadt am Kulm.
- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 1998: Aspekte der
Siedlungsgeschichte, oder: Die permanente Ethnogenese, in: Heimat
Landkreis Tirschenreuth 10: 46-57.
- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 2001: Erwähnungen von Slawen in
historischen Quellen. Landkreis Tirschenreuth im Kontext der Diskussion
der Siedlungsgrenze. Heimat Landkreis Tirschenreuth 13: 205-212.
- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 2007: Beitrag zur Geschichte der
alten Gemeinde Haidenaab. In: Haidenaab und Göppmannsbühl. Beiträge zur
Ortsgeschichte, Speichersdorf (Hrsg.): 47-118
- Nitz, Hans-Jürgen 1991: Mittelalterliche Raumerschließung und
Plansiedlung in der westlichen regio Egere als Teil des historischen
Nordwaldes. Oberpfälzer Heimat. 35. Band: 7-55. Weiden.
- Quast, Dieter, mit einem Beitrag von Mären Siegmann 2000: Amulett? -
Heilmittel? -Schmuck? Unauffällige Funde aus Oberflacht. Archäologisches
Korrespondenzblatt. Jahrgang 30: 279-294. Mainz.
- Pöllath, Ralph 2002: Karolingerzeitliche Gräberfelder in
Nordostbayern. Eine archäologisch-historische Interpretation mit der
Vorlage der Ausgrabungen von K. Schwarz in Weismain und Thurnau-Alladorf
(4 Bände). München, Scheßlitz.
- Raßhofer, Gabriele 2007: Neue Forschungen am „Rauhen Kulm". Teil 1:
Die vorgeschichtlichen Funde am Rauhen Kulm: Neue Erkenntnisse zur
prähistorischen Besiedlung im Norden der Oberpfalz. Chyträcek, Miloslav,
Michälek, Jan, Rind, Michael M. und Schmotz, Karl (Hrsg.):
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen.
Archeologickä pracovni skupina vychodni Bavor-sko/zäpadni a jinni Cechy.
16. Treffen 21. bis 24. Juni 2006 in Plzen-Kfimice: 107-118. Rahden/Westf.
- Reindel, Kurt 1981: B Grundlegung. Das Zeitalter der Agilolfinger (bis
788). C Bayern vom Zeitalter der Karolinger bis zum Ende der
Weifenherrschaft (788-1180). In: Spindler, Max (Hrsg.): Handbuch der
bayerischen Geschichte. Band I. Das Alte Bayern. Das Stammesherzogtum
bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts: 101-349. München (2. Auflage).
- Röhrer-Ertl, Olav 1998: Die Skelett-Reste des slawischen
Reihengräberfeldes vom Barbaraberg bei Speinshart, Landkreis Neustadt
a.d. Waldnaab, Oberpfalz. Eine Fallstudie zu Bevölkerungsbiologie und
Bevölkerungsgeschichte. In: Heidenreich: 155-180.
- Röhrer-Ertl, Olav 1999: Slawen - Deutsche. Beiträge zum ethnischen
Wandel aus anthropologischer Sicht. Otnant-Gesellschaft für Geschichte
und Kultur in der Euregio Egrensis. Quellen und Erörterungen 2.
Pressath.
- Schneider, Erich und Schneidmüller, Bernd 2004: Vor 1000 Jahren - Die
Schweinfurter Fehde und die Landschaft am Obermain 1003. Referate des
wissenschaftlichen Kolloquiums am 4. und 5. Juli 2003 in der Bibliothek
Otto Schäfer in Schweinfurt. Schweinfurter Museumsschriften Band
118/2004. Schweinfurt.
- Schuster, Adolf Wolf gang 1990: Geschichte der Gemeinde Flossenbürg.
Band I. Flossenbürg, Weiden.
- Schwarz, Ernst 1960: Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Erlanger
Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft. Band IV. Nürnberg.
- Slupecki, Leszek Pawel 2000: Heidnische Religion westlicher Slawen.
In: Wieczorek, Alfried und Hinz, Hans-Martin (Hrsg.): Europas Mitte um
1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur
Ausstellung: Band 1: 239-251. Stuttgart.
- Stloukal, Milan, Szilvässy, Johann und Sebesta, Pavel 1988: Die
slawische Gräberstätte auf der Kaiserburg in Cheb (Eger). Pamätky
Archeologicke. Band LXXIX: 390-423. Prag.
- Stroh, Armin 1975: Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmäler
der Oberpfalz. Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte. Reihe B.
Heft 3. Kallmünz/Opf.
- Tovornik, Vlasta 1988: Die Slawen. In: Dannheimer, Hermann und Dopsch,
Heinz (Hrsg.) 1988: Die Bajuwaren. Von Severin bis Tassilo 488-788.
Gemeinsame Landesausstellung des Freistaates Bayern und des Landes
Salzburg: 118-128. Rosenheim/ Bayern, Mattsee/Salzburg. Korneuburg.
- Wagner, Illuminatus (Bearb.) 1952 (2. Auflage): Geschichte der
Landgrafen von Leuchtenberg. I. Teil. Älteste Geschichte ca. 1100-ca.
1300. Kallmünz."
[Hans Losert in: Neubauer, Michael und Thieser, Bernd:
Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm in der Flednitz: 65-87. In:
Kemnath 1000 Jahre ... und mehr (Heimatbuch zum 1000-jährigen Bestehen)
2007 - Zwischenüberschriften vom Bearbeiter]
|
|
[Zurück zum
1. Teil 2006/2007]
[Zurück
zur Übersicht]
=> Weiter
zum Missionskreuz
=> Weiter
zur Sonderausstellung
"Archäologie ohne Grenzen"
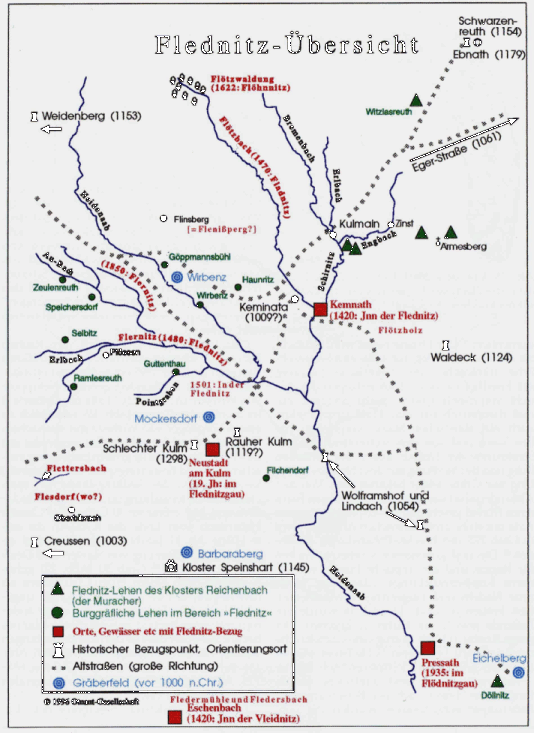
Abb. 16: Flednitz, das Gebiet um den Rauhen Kulm an der
oberen Heidenaab, Erwähnungen des Begriffs Flednitz.
[Aus Neubauer & Thieser 2007, Abb. 2]
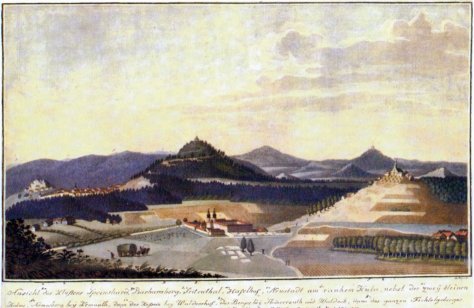
Abb. 17: Blick in die Flednitz von Süden
mit Rauhem Kulm, Kloster Speinshart und Barbaraberg. Historische Ansicht
von 1825 [Freundliche Vermittlung durch Georg Miedel, Neustadt am Kulm]
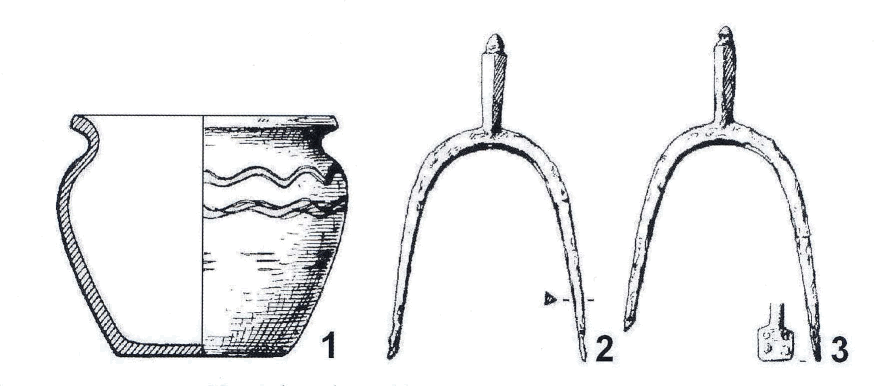
Abb. 18: Eichelberg, Lkr. Neustadt an der
Waldnaab, Marteranger, l Grab 2, Alter und Geschlecht unbestimmt,
Tongefäß (Höhe 11,8 cm) des 8.19. Jahrhunderts, 2-3 Grab 7, Mann mit
Sporen (Länge 16,3 cm), Beisetzung im 9. Jahrhundert. [Stroh 1954: Taf.
17; E1, 3-4]
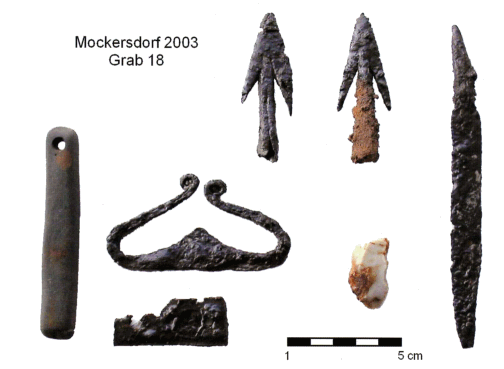
Abb. 19: Mockersdorf, Lkr. Neustadt an
der Waldnaab, Bühl.
Grab 18, Knabe, 11-13 Jahre alt, Beisetzung im 8./9. Jahrhundert. [Foto:
Hans Losert]

Abb. 20: Mockersdorf, Bühl. Grab 22,
Frau, 30-40 Jahre alt, Beisetzung im 8./9. Jahrhundert.
[Foto: Hans Losert]
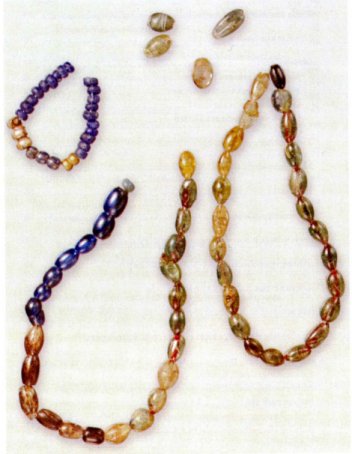
Abb. 21: Wirbenz, Lkr. Bayreuth,
Kalkäcker. Glasperlen aus den Frauengräbern 4, 10,16, 17 und 28, 8. bis
frühes 10. Jahrhundert [Haberstroh, C. 2004: 8]
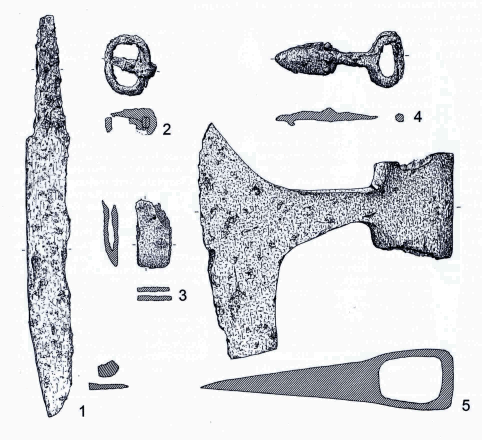
Abb. 22: Wirbenz. 1-5 Grab 30,
Mann, 40-60 Jahre alt, mit Gürtelschnalle, Riemenzunge, Riemenbesatz mit
zungenförmigem Ende (Länge 7,5 cm), Messer (Länge 23,2 cm) und Bartaxt
(Länge 14,6 cm), Beisetzung nach Radiocarbonanalyse frühestens um 1000?
[Haberstroh, C. 2004, Taf. 7; 11-15]
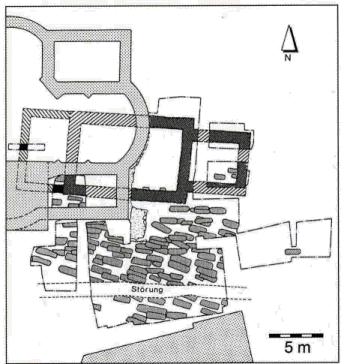
Abb. 23: Barbaraberg, Lkr. Neustadt an
der Waldnaab.
Kirche der Zeit um 1000 und Gräberfeld des 9./10. Jahrhunderts.
[Heidenreich 1997: Abb. 113]
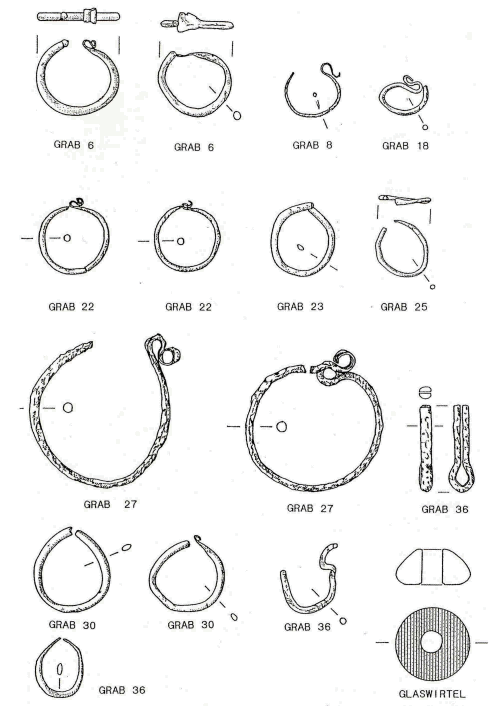
Abb. 24: Barbaraberg, Lkr. Neustadt an
der Waldnaab.
Ausgewählte Funde aus dem Gräberfeld des 9./10. Jahrhunderts.
[Heidenreich 1997: Abb. 113]
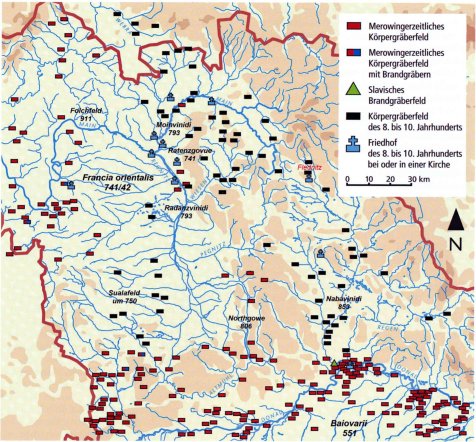
Abb. 25: Frühmittelalterliche
Gräberfelder in Nordbayern.
[Losert 2007, kartographische Umsetzung: Guido Apel, Bamberg]
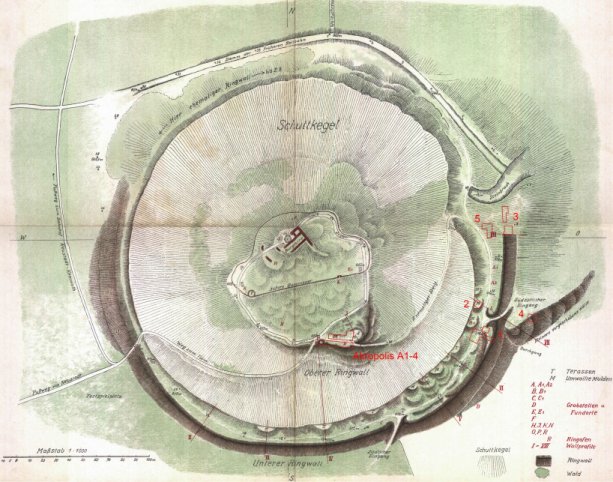
Abb. 3: Rauher Kulm, Plan der
Befestigungen
und Schnitte
[Neischl 1912: Planbeilage II]
=> Weiter zum Missionskreuz
=> Weiter
zur Sonderausstellung
"Archäologie ohne Grenzen"
[Zurück
zum 1. Teil 2006/2007]
[Zurück
zu den Ausgrabungen
am Rauhen Kulm 2003]
[Zurück
zur Übersicht]
|
![]() nach oben [home]
Dieter Schmudlach - 11.02.08.2010/26.09.2010
nach oben [home]
Dieter Schmudlach - 11.02.08.2010/26.09.2010