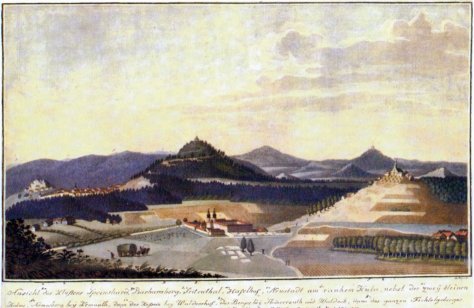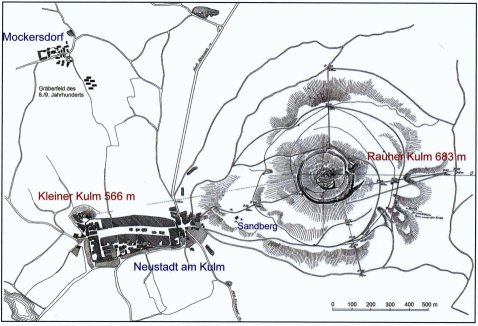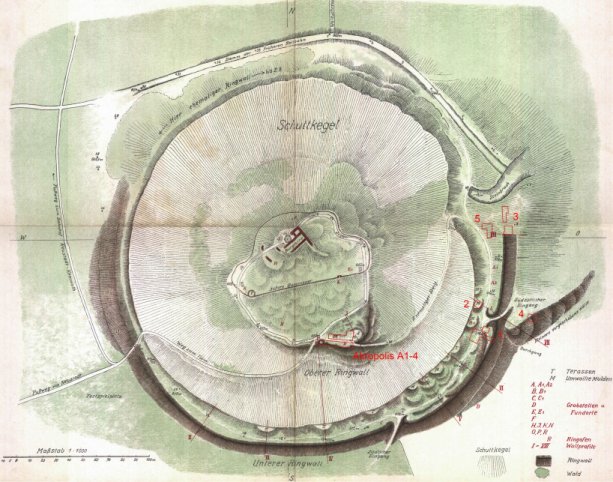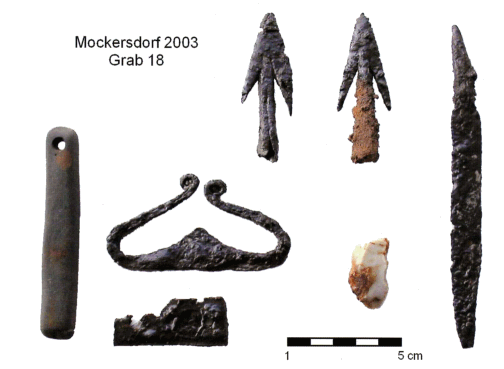Der Rauhe Kulm,
die Flednitz und das Egerland
Zur Sonderausstellung im Rathaus (alte Post) von Neustadt am Kulm
vom 23. Juli 2010 bis 31. Oktober 2010
"In den
letzten Jahren fanden in der slawischen Siedlungskammer Flednitz - nach
deren Wiederentdeckung durch Michael Neubauer und Bernd Thieser - eine
Reihe interdisziplinärer Untersuchungen statt, die unsere Kenntnisse von
der Siedlungsgeschichte in der nördlichen Oberpfalz beträchtlich
erweiterten. Daran beteiligt waren unter anderen Archäologen,
Schrifthistoriker, historische Geographen, Namensforscher, aber auch
heimatverbundene Laien. Dabei wurde immer deutlicher, dass während des
frühen und hohen Mittelalters im nordöstlich benachbarten Egerland
vergleichbare historische Voraussetzungen herrschten, so dass die Idee
geboren wurde, beide Regionen erstmals in einer Ausstellung
vorzustellen,
Seit
2004 finden auf dem Rauhen Kulm, dem natürlichen und administrativen
Zentrum der Flednitz im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes
der Universitäten Bamberg (Hans Losert, Lehrstuhl für Archäologie des
Mittelalters und der Neuzeit) und Wien (Erik Szameit, Institut für Ur-
und Frühgeschichte) Ausgrabungen statt. Erste Untersuchungen in den
Jahren 1908-1910 durch Adalbert Neischl, vorgelegt in einer der
frühesten archäologischen Monographien Nordbayerns, belegten, dass der
Basaltkegel vom Neolithikum an immer wieder aufgesucht wurde und auch im
frühen Mittelalter intensiv genutzt wurde.
Die
neuen Untersuchungen galten zunächst der unteren Umwehrung, dessen
Nordhälfte allerdings im späten 19. Jahrhundert bei Anlage einer Rampe
zum Abtransport von Basalt für Straßen- und Schienenbau stark verändert
und durch einen tiefen Steinbruch am Osthang zerstört wurde. Es zeigte
sich, dass im Ringwall eine zweifrontige Trockenmauer steckt, an die auf
der Innenseite eine durch Keramik ins 8. bis 10. Jahrhundert nach
Christus datierte Kulturschicht stößt. Die frühmittelalterliche
Hangmauer wurde dann um 900-950 durch eine mächtige Anschüttung von
Basaltblöcken gegen die Vorderfront in einen breiten Wall umgewandelt,
Die zeitliche Einordnung stützt die Beobachtung, dass in vorgelagerten,
den Weg zum Osttor begleitenden bogenförmigen Terrassen gestaffelte
Annäherungshindernisse stecken, wie sie typisch für Befestigungen der
ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts gegen die Ungarn sind.
Seit
2008 fanden auch Grabungen an der oberen Umwehrung der Akropolis statt.
Nach Beseitigung des seit den 1960erjahren stark verdichteten
Unterholzes zeigte sich, dass hier recht komplizierte Befunde vorliegen,
die wohl zu mehrfach gestaffelten Torkammern des 9. bis 10.
nachchristlichen Jahrhunderts gehören. Auch dort steckt im Ringwall eine
zweifrontige Mauer. Das Fundgut entspricht weitgehend dem der Unterburg.
Anders als dort liegen hier aber auch Gegenstände vom späteren 10.
Jahrhundert bis zur Zerstörung der Zollernburg 1554 vor. Bemerkenswert
ist vor allem ein
Bleikreuz, das während der frühmittelalterlichen Mission einem
Täufling überreicht wurde. Dieser erste Hinweis auf frühes Christentum
vom Rauhen Kulm ist sicher älter als die früheste bekannte Kirche der
Region, die um 1000 auf dem benachbarten Barbaraberg entstand.
Der
Rauhe Kulm bildete wie andere markante Vulkane, etwa der Parkstein, in
allen Zeiten einen wichtigen Orientierungspunkt für Menschen, die auf
Mobilität Im weitesten Sinne angewiesen waren. Die Lage der Landmarke an
bis in die Gegenwart genutzten Fernwegen, etwa vom Donaugebiet um
Regensburg nach Mitteldeutschland oder ins Obermaingebiet, aber auch von
Westen über das Egerland oder Pilsen nach Böhmen, steht damit in
unmittelbarem Zusammenhang. Als Bauherren für die jüngste Phase des
unteren und oberen Ringwalls, dessen Errichtung einen erheblichen
Arbeitsaufwand darstellte, zumal dazu ja auf der Mauerkrone ein
hölzerner Laufgang mit Brustwehr gehört haben mußte, kommen am ehesten
die Schweinfurter Markgrafen in Frage. Neben der Anlage von
Bayreuth-Laineck und der Burg zu Eger waren deren am weitesten im
Nordosten gelegenen Stützpunkte im 10. Jahrhundert Teil der
ostfränkisch-nordbayerischen Mark gegen Böhmen.
Zusammen mit den slawischen Nekropolen von Eichelberg, Mockersdorf und
Wirbenz, dem etwas jüngeren Friedhof mit nachträglich darin errichteter
Kirche auf dem Barbaraberg und der Siedlung auf dem Netzaberg bei
Eschenbach ist die Befestigung auf dem Rauhen Kulm Zeugnis des zunächst
überwiegend von Naabwenden getragenen früh- bis hochmittelalterlichen
Landesausbaus an der oberen Haidenaab."
Die
Sonderausstellung im Rathaus (alte Post) von Neustadt am Kulm ist
vom 23. Juli 2010 bis 31. Oktober 2010 jeden Sonntag von 14:00 - l 7:00
Uhr
und nach Anfrage geöffnet.
Tel
09648 / 273 Mail
neustadt-am-kulm@t-online.de
[Text nach einem Flyer „Archäologie ohne Grenzen“
– Design: Dipl. Designerin Stefanie Schecklmann]
=> [Zurück
zur Übersicht] |
|
=> Zurück
zu den Ausgrabungen von 2004
=> Zurück zum Missionskreuz
=>
Zurück
zur Übersicht
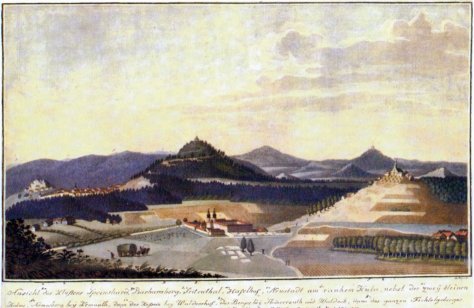
Abb. 1: Blick in die Flednitz von Süden
mit Rauhem Kulm, Kloster Speinshart und Barbaraberg. Historische Ansicht
von 1825 [Freundliche Vermittlung durch Georg Miedel, Neustadt am Kulm]
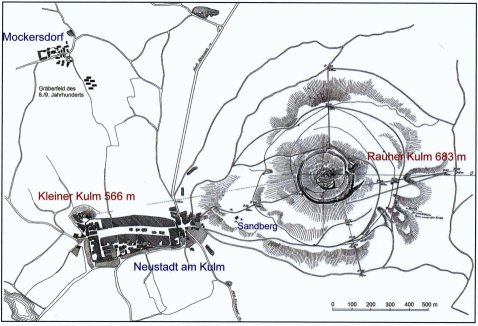
Abb. 2: Neustadt mit dem Rauhen Kulm im
Osten und dem
Kleinen Kulm im Westen sowie Mockersdorf
(li. oben] mit der slawischen
Nekropole des 8./ 9. Jhdts.
[nach Neischl 1912: Planbeilage I]
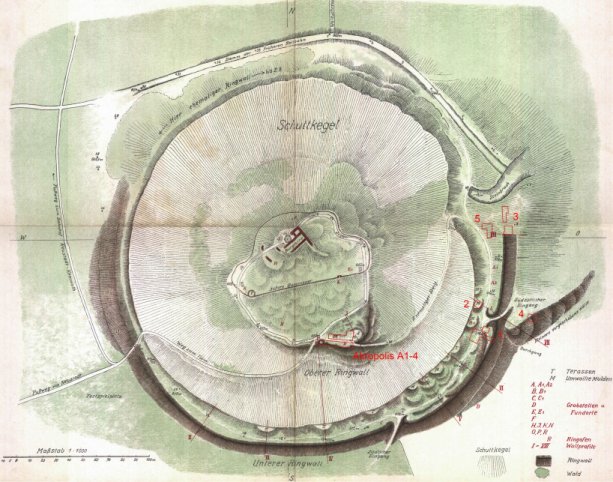
Abb. 3: Rauher Kulm, Plan der
Befestigungen
[Neischl 1912: Planbeilage II]

Abb. 4: Das Missionskreuz aus Blei vom Rauhen Kulm
in der Sonderausstellung "Archäologie ohne Grenzen"
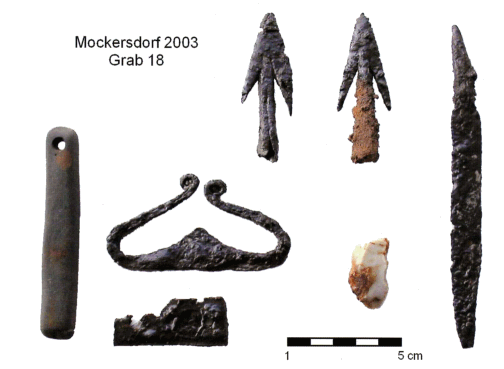
Abb. 5: Mockersdorf, Lkr. Neustadt an
der Waldnaab, Bühl.
Grab 18, Knabe, 11-13 Jahre alt, Beisetzung im 8./9. Jahrhundert.
[Foto:
Hans Losert]
=> [Zurück zum Missionskreuz]
=> [Zurück
zum 1. Teil 2006/2007]
=> [Zurück
zu den Ausgrabungen
am Rauhen Kulm 2003]
|
![]() nach oben [home]
Dieter Schmudlach -
23.08.2010/14.09.2010
nach oben [home]
Dieter Schmudlach -
23.08.2010/14.09.2010