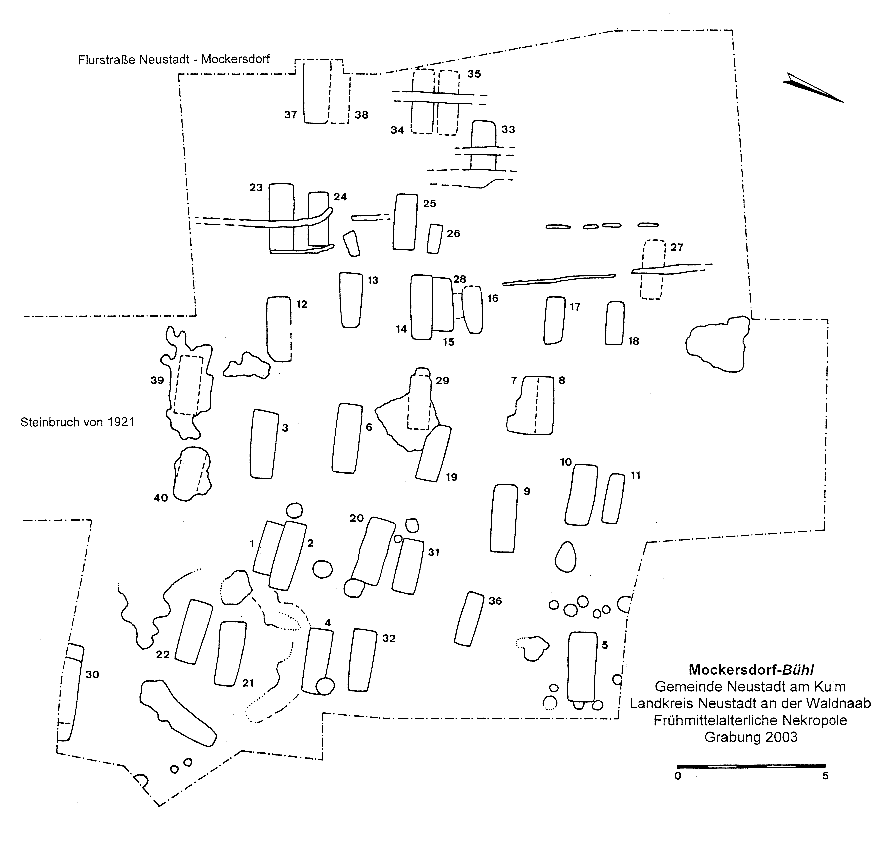|
Anlass der Untersuchungen
Die schon 1921 bei der Anlage eines Steinbruchs angetroffene Nekropole
liegt in der Flur Bühl an einem Verbindungsweg zwischen Neustadt
am Kulm und Mockersdorf etwa 1km nördlich unterhalb von Neustadt am Kulm
(Abb. 1 und 2). Wegen der im Frühjahr 2004 geplanten Erneuerung der Flurstraße
sollte eine archäologische Prospektion klären, wo das mittlerweile nicht
mehr genau lokalisierbare Gräberfeld liegt und ob hier noch weitere
Bestattungen zu erwarten sind. Nach Anlage einer Baggersondage parallel
zur Straße unter Aufsicht von Dr. M. Hensch (Bamberg) wurde zunächst der
kleine Steinbruch von 1921 an der höchsten Stelle der Kuppe entdeckt und
es zeigte sich, dass nördlich davon zahlreiche Gräber erhalten waren.
Darauf folgte eine archäologische Untersuchung im Rahmen einer
Lehrgrabung des Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der
Neuzeit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg sowie des Instituts für
Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien.
Frühere Grabungen
Bei der Anlage des Steinbruchs von 1921 wurden etwa 40 ungefähr west-ost
orientierte Gräber beobachtet. Eine Dokumentation ist nicht erhalten,
jedoch wurde ein Großteil der Funde in der Arbeit von Armin Stroh über
die Reihengräber der karolingisch-ottonischen Zeit in der Oberpfalz
aufgenommen. Häufigste Funde waren Kopfschmuckringe unterschiedlicher Größe
mit S-Schleifen und Messer. Dazu kamen zwei Äxte mit kurzen
Schaftlochlappen und ein außergewöhnliches vergoldetes Bronzebeschläg
in Form eines Rinderkopfes. Von den 1921 beobachteten und ausgenommenen Gräbern
wurden bei der diesjährigen Untersuchung drei Gruben unmittelbar am nördlichen
Rand des Steinbruchs lokalisiert (Gräber 30, 39, 40), die übrigen fielen
diesem zum Opfer. In der Mitte der untersuchten Fläche liegt eine
unregelmäßige Grube mit Scherben neuzeitlicher glasierter Gefäßen, die
ebenfalls eine Bestattung (Grab 29) zerstörte. Eine hier angetroffene
Silbermünze des späten 18. Jahrhunderts könnte dafür sprechen, dass
auf dem Bühl schon früher nach Gräbern gesucht wurde. In einer
Fläche von etwa 460 m² östlich und nordöstlich der höchsten Stelle
der Kuppe wurden 40 Bestattungen dokumentiert. Obwohl in alten Karten in
einem schmalen Streifen auch westlich davon Gräber eingezeichnet sind,
ergaben hier zwei Suchschnitte keine Spuren von Bestattungen. Dass Gräber
auch unmittelbar unter der Straße lagen und diese kaum hohlwegartig
ausgeprägt war, was bei längerer intensiver Nutzung zu erwarten wäre,
spricht gegen Deutung als bedeutende Altstraße.
Lage des Gräberfeldes
Der nach Süden und Westen ansteigende Bühl wird zu Mockersdorf
hin abwechselnd durch Felsrippen, festen Sand und roten Letten gegliedert.
Die locker in regelmäßigen Reihen angelegten Gräber wurden im Westen
teils in den anstehenden Sandstein gegraben, öfter lagen sie jedoch auf
oder neben diesem, im Ostteil ermöglichte der einheitlichere sandige
Untergrund stärkere Eintiefung der Gruben. Zur Straße hin waren einige
Bestattungen bereits stark vom Pflug in Mitleidenschaft gezogen. Da durch
Erosion und landwirtschaftliche Nutzung seit Nutzung der Nekropole sicher
mehr als 1 m Boden abgetragen wurde, ist von einer ursprünglichen
Grabtiefe bis mindestens 2 m auszugehen. Einige der durchwegs west-ost
orientierten Bestattungen wiesen am Kopf- und Fußende sowie an den Seiten
lockere Steinsetzungen auf. Besonders deutlich war dies bei den Gräbern
5, 6 und 20. Über Grab 5 wurde in Pfostenbauweise ein einfacher
Memorialbau errichtet, die Bestattungen 21 und 22 umgab vielleicht ein
Kreisgraben. Die direkte Nachbarschaft einiger Bestattungen gibt familiäre
Bindungen wie Mutter-Kind oder Mann-Frau wieder, Grabüberschneidungen
kommen nicht vor. Im Norden, wo schwer zu bearbeitender Letten ansteht, dürfte
die Grenze des Gräberfeldes erreicht worden sein, die Erstreckung nach
Osten ist unbekannt. Im Nordteil der Nekropole scheint sich ein etwa 2m
breiter ost-west gerichteter Weg abzuzeichnen. Die Erhaltung der Skelette
war sehr unterschiedlich, vor allem bei tiefer im Sandboden liegenden
Bestattungen im Nordosten war diese auch bei erwachsenen Individuen sehr
schlecht.
Trachtbestandteile und Ausstattung
Fast alle Gräber, die nicht durch landwirtschaftliche Tätigkeit oder
Wegebau beeinträchtigt waren, enthielten Trachtbestandteile.
Bemerkenswert ist Frauengrab14 mit zwei silbernen Kopfschmuckringen,
einer mit mehr als 300 kleinen Glasperlen bestickten Kopfbedeckung oder
einem Stirnband, Messer sowie bronzenem Fingerring. Grab 2 enthielt zwei
bronzene Kopfschmuckringe, 20 Mehrfachperlen aus gelben, blauen oder
farblosen Glas, letztere mit Auflagen aus Silber- oder Goldfolie, eine
Bernsteinperle und eine eiserne Herzspiralnadel, wie sie auch in Grab 22
beobachtet wurde. Eine Bronzenadel mit einfach eingerolltem Kopf stammt
aus Grab 12. Den Frauen in Grab 12 und 14 wurden am Fußende als
Speisebeigabe jeweils ein Huhn mitgegeben. Alle Knaben und Männer waren
mit Messern ausgestattet. Grab 3 enthielt zusätzlich einen Pfriem zur
Holz und Lederbearbeitung. Dem jungen Knaben in Grab18 hatte man in einer
Gürteltasche ein Feuerzeug, bestehend aus Feuerstahl und Feuerstein,
einen in oberpfälzischen Gräbern dieser Zeitstellung bislang
einzigartigen feinen Schleifstein (Länge 7,5 cm, Breite 1,5 cm) mit
Durchbohrung (Abb. 5) und ein Messer mitgegeben; daneben lagen zwei geflügelte
Pfeilspitzen.
Keine Ruhe im Grab
Außergewöhnlich sind zahlreiche Bestattungen, bei denen nach der
Beisetzung Veränderungen vorgenommen wurden, die wohl im weitesten Sinne
mit symbolischer Bannung des Toten bzw. Angst vor Wiedergängern zu tun
haben. So wurde bei fast allen Skeletten der Schädel sekundär verlagert.
In Grab 6 wurde er auf dem entnommenen Unterarm aufgespießt, in Grab 4
unter einem fast die ganze Grabbreite einnehmenden Sandstein zerdrückt.
Da die übrigen Knochen dabei nicht bewegt wurden, geschah dies, als kein
Sehnenverband mehr bestand, die Verwesung des Leichnams also abgeschlossen
war, vielleicht nach Aufgabe der Nekropole. Inwieweit hier ein
Zusammenhang mit dem Übergang vom Heiden- zum Christentum besteht, ist
unbekannt. Besonders eindrucksvoll ist Grab 22, das nach Verlagerung des
Kopfes mit zahlreichen großen Sandsteinbrocken verfüllt wurde.
Wenigstens ein Jugendlicher und Erwachsener wurden auf dem Bauch liegend
beerdigt (Grab 19 und 37). Vergleichbare Praktiken sind für die
benachbarte Nekropole von Eichelberg, aber auch in dem schon 1937
ausgegrabenen Gräberfeld von Matzhausen im Truppenübungsplatz Grafenwöhr
überliefert.
Ortsfriedhof von Mockersdorf
Die Lage auf einer flachen, vom Tal aus gut einsehbaren Kuppe, etwa 500 m
südöstlich der Mockersdorfer Pfarrkirche St. Michael spricht dafür,
dass auf dem Bühl die Gründer des erst verhältnismäßig spät
urkundlich überlieferten Ortes und deren Nachkommen bestattet wurden.
Dabei war die Nähe zu den markanten Landmarken des Rauhen und Schlechten
Kulms sicher beabsichtigt (Abb. 2). Spätestens mit Errichtung einer
ersten Kirche in der näheren Umgebung wurde das Gräberfeld aufgegeben.
Die karolingerzeitlichen Bestattungen dokumentieren zusammen mit den
Nekropolen von Eichelberg, Wirbenz, dem insgesamt etwas jüngeren Friedhof
mit nachträglich darin errichteter Kirche auf dem Barbaraberg und den
Funden der Befestigung auf dem Rauhen Kulm, wo bei Grabungen durch
Adalbert Neischl 1912 gleichzeitige Funde angetroffen wurden, den zunächst
überwiegend von Slawen getragenen frühmittelalterlichen Landesausbau in
der Flednitz, der Siedlungskammer um den Rauhen Kulm.
Deutsch-österreichische Forschungskampagne
Die Ausgrabung wurde im Rahmen des internationalen Projekts Die
mittlere und nördliche Oberpfalz und ihre Nachbarregionen im frühen
Mittelalter als deutsch-österreichische Forschungskampagne mit
Studenten vom Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien
und des Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der
Otto-Friedrich Universität Bamberg durchgeführt. Hervorzuheben ist die
sehr gute Unterstützung, die uns von der Stadtverwaltung in Neustadt am
Kulm, besonders durch Bürgermeister K. Pühl, dem Kreisheimatpfleger
Dipl. Ing. H. J. Oberndorfer und der Direktion für ländliche Entwicklung
in Regensburg entgegengebracht wurde. Ebenso bemerkenswert war das große
Verständnis und Interesse des Grundbesitzers, des Pächters und der
Bewohner von Mockersdorf.
Literatur
A. Heidenreich, Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem
Barbaraberg im Landkreis Neustadt/Waldnaab. Otnant-Gesellschaft für
Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis. Mit einem anthropologischen
Anhang von O. Röhrer-Ertl. Archäologische Zeugnisse zur
Siedlungsgeschichte. Band 1 (Pressath 1998). - C. Krebs, Ein
karolingischer Friedhof bei Wirbenz. Gemeinde Speichersdorf, Landkreis
Bayreuth, Oberfranken. Arch. Jahr Bayern 1997, 146 ff. A. Neischl, Die
vor- und frühgeschichtlichen Befestigungen am Rauhen Kulm bei Neustadt a.
Kulm (Oberpfalz) (Nürnberg 1912). - A. Stroh, Die Reihengräber der
karolingisch-ottonischen Zeit in der Oberpfalz. Materialh. Bayer. Vorgesch.
4 (Kallmünz 1954)
Texte und Bilder:
H. Losert und E. Szameit
[Archäologische Untersuchungen im wieder entdeckten
frühmittelalterlichen Gräberfeld von Mockersdorf, Stadt Neustadt a. Kulm,
Landkreis Neustadt a. a. Waldnaab, Oberpfalz.
In: Das Archäologische Jahr in Bayern 2003, S. 101-103]
|
|
[zurück
zur Ausgrabungsübersicht]
[zurück
zur Übersicht]

Abb. 1: Das Grabungsgelände oberhalb von Mockersdorf

Abb. 2: Beginn der Grabungen auf dem Bühl,
im Hintergrund der Rauhe Kulm.

Abb. 3: Meist war das Wetter ungemütlich: kalt und nass!
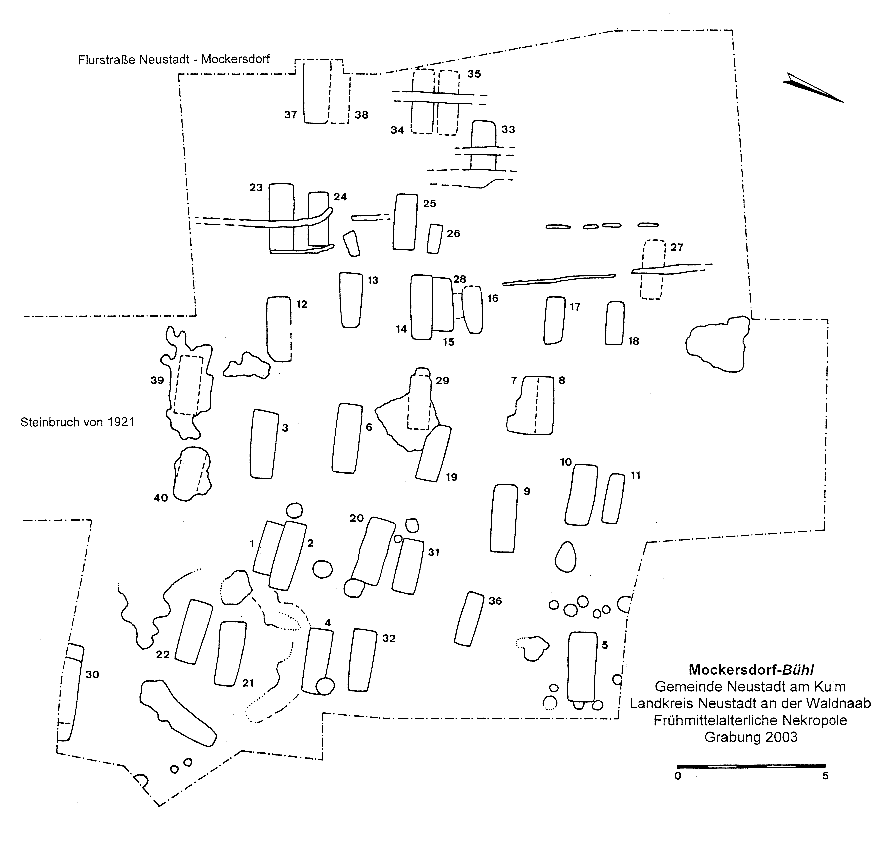
Abb. 4: Plan der Grabung Mockersdorf-Bühl 2003
im frühmittelalterlichen Reihengräberfeld

Abb. 5: Wetzstein (7,5 cm lang)
aus dem Knabengrab 18
=> Weitere Bilder
/ Funde
=> Plan des
Gräberfeldes
=>
Die Ausgrabungen am Rauhen Kulm
2004
[zurück
zur Ausgrabungsübersicht]
[zurück
zur Übersicht]
|
![]() nach
oben
[home]
Dieter Schmudlach
- 20.02.2004/14.09.2010
nach
oben
[home]
Dieter Schmudlach
- 20.02.2004/14.09.2010