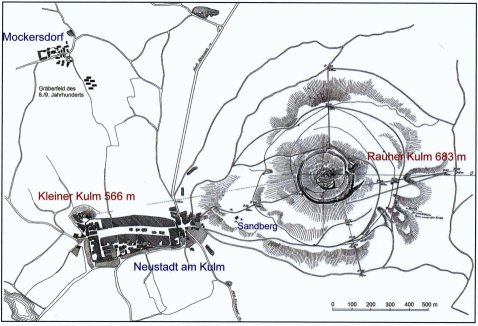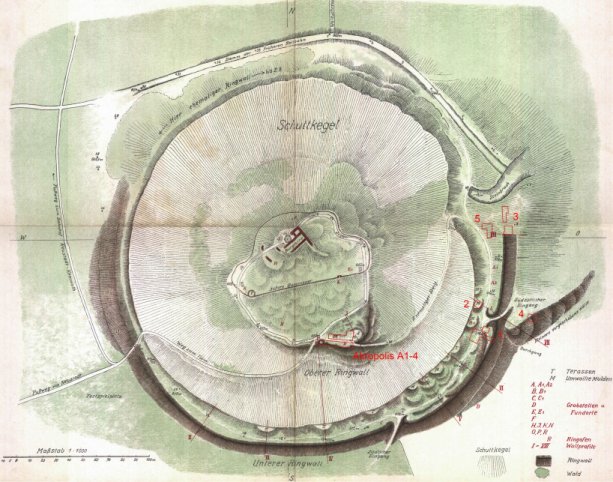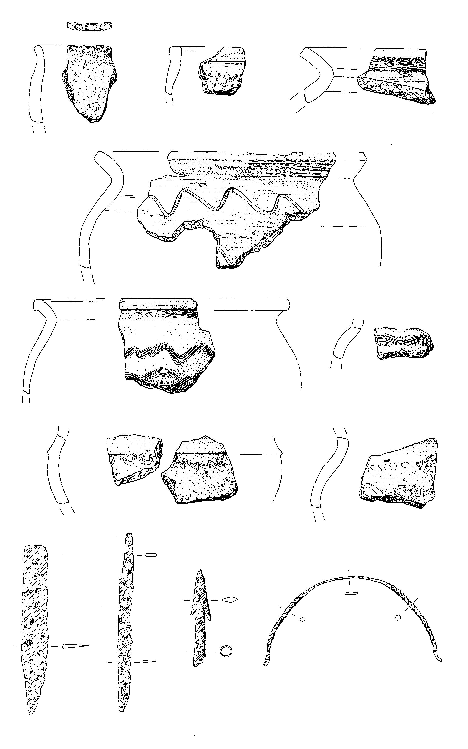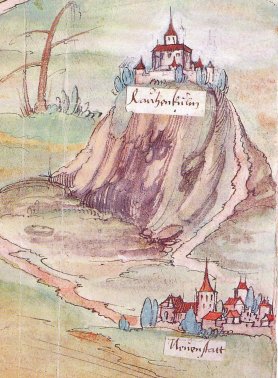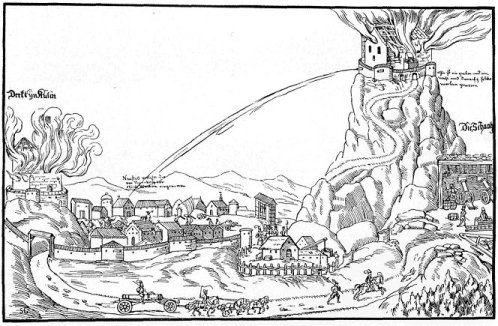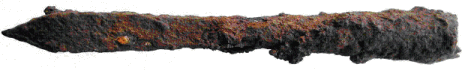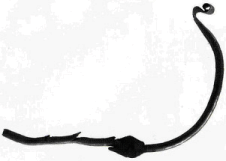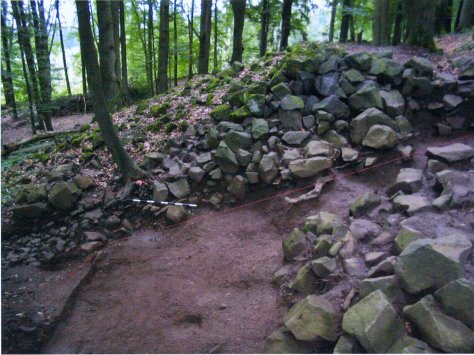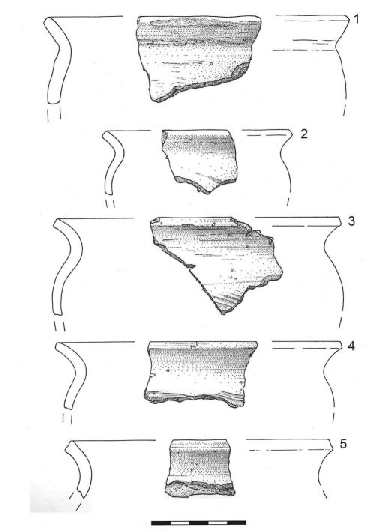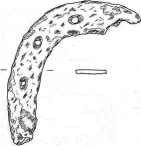|
Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm
in der Flednitz (Hans Losert): 1. Teil
"Ganz in der Nähe von Kemnath liegt eine
der auffälligsten Landmarken Nordostbayerns; wären da nicht
unterschiedliche historische Grundlagen und die heutige Landkreisgrenze,
könnte man den Rauhen Kulm leicht als Kemnaths Hausberg bezeichnen. Der
gleichmäßige Kegel überragt mit 683,5 Meter Höhe die Oberpfälzer Senke
bzw. das nördliche Oberpfälzische Bruchschollenland um bis zu 233 Meter.
Zusammen mit dem unmittelbar benachbarten Kleinen oder Schlechten Kulm
am Nordwestrand von Neustadt (Abb. 1), dem Waldecker Schloßberg,
Armesberg sowie Parkstein gehört er zu einer Reihe von Basaltmassiven,
die auf vulkanische Aktivitäten zurückgehen. Der Berg im südlichen
Fichtelgebirgsvorland machte in allen Epochen auf den Menschen Eindruck
und so verwundert es kaum, dass dieser nicht erst im hohen Mittelalter
aufgesucht und befestigt wurde.
[Frühe Forschungen]
Im
Bereich des außergewöhnlichen Natur- und Kulturdenkmals, um das sich
zahlreiche Sagen ranken (1), fanden bereits sehr
früh archäologische Schürfungen statt (Abb. 1-3). Die in den Jahren
1908-1910 von Major Dr. Adalbert Neischl (1853-1911) im Auftrag der
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg durchgeführten Untersuchungen,
deren Ergebnisse 1912 posthum von Prof. Dr. Hugo Obermaier in einer für
die Zeit vorbildhaften Monographie vorgelegt wurden, belegten, dass der Rauhe Kulm vom Neolithikum an immer wieder aufgesucht wurde, obgleich
vorgeschichtliche Funde sonst aus der näheren Umgebung bis in jüngste
Zeit fast völlig fehlten (siehe den Beitrag Gabriele Raßhofer in diesem
Band). Die frühe Bedeutung des Platzes wird durch ein in den späten
1960er-Jahren aufgelesenes und hier im Schuttkegel möglicherweise als
Opfer niedergelegtes unbenutztes Bronzebeil der späten Bronzezeit
unterstrichen. (2) Keramik und Eisenobjekte des
8./9. nachchristlichen Jahrhunderts (Abb. 3) sprachen seit den
Untersuchungen von Neischl dafür, dass hier ein zentraler Ort der
Karolingerzeit bestand. [Neischl 1912: Planbeilage II]
[Zum
Namen Kulm]
Die Bezeichnung
Kulm wurde vom germanischen, wohl gotischen *hulmaz für
Hügel über das altslawische ch-'blm'b
in allen slawischen Sprachen als Bezeichnung für Hügel und Berg
übernommen. (3) Verwandt ist
das lateinische culmen - Gipfel, Kuppe, das im Schweizerdeutschen
als Kulm, Chulme(n) oder Gul-m(en) für oberste
Bergkuppe gebraucht wird. Flurnamen wie Kolm, Külmitz, Kolmacker
etc. sind im Gebiet zwischen Obermain und Naab sehr häufig. Ernst
Schwarz nahm daher an, dass Kulm hier auch von Franken und Bayern aus
dem Slawischen entlehnt wurde (4) und bezieht das
Egerland bzw. obere Egergebiet, wo mit dem 1432 erstmals genannten
Rauhenkulm beim Wallfahrtsort Maria Kulm (Chlum-Svate Mari) 14 km
nordöstlich von Eger eine bemerkenswerte Namensentsprechung vorliegt, in
die Zone der nordbayerischen Kulme ein. (5)
Der
Berg bildet den natürlichen Mittelpunkt einer historischen
Siedlungslandschaft an der oberen Heidenaab (Abb. 16-17), deren
slawischer Name, wie Michael Neubauer und Bernd Thieser nachweisen
konnten, (6) seit dem späten
Mittelalter als Flednitz überliefert ist. (siehe den Beitrag von
Wolfgang Janka in diesem Band).
Vergleichbare Bezeichnungen einer im weitesten Sinne wasserreichen bzw.
sumpfigen Landschaft lassen sich bis in die Ostalpen nachweisen, für
Nordbayern ist schon 1009 ein aqua Fladniza von altslawisch
Blat'bnica
für Sumpfbach zu altslawisch blato -Sumpf, heute Flanitz, Lkr.
Regen belegt. (7)
[Zupane - Vertreter des örtlichen Adels]
Die
verhältnismäßig späten Nennungen von Zupanen - ursprünglich bei den
Awaren Bezeichnung für den Anführer eines Stammes (8)
- hier entweder eine slawische Bezeichnung für Vertreter des örtlichen
Adels und/oder den Vorstehenden eines überschaubaren slawischen
Siedlungsverbandes - 1259 Henricus de Berensteine Suppanus nach
einem Ort 4 km nördlich von Windisch Eschenbach, Lkr. Neustadt/
Waldnaab, 1260 der Graf von Murach, genannt Suppan bei
Oberviechtach, Lkr. Schwandorf, (9) 1270
Suppanus Heinricus de Bernstein (10) und 1272
Heinri(cus) de Bibrach suppanus aus Oberbibrach, Lkr.
Neustadt/Waldnaab 6 km südöstlich vom Rauhen Kulm (11)
- sowie zeitgleiche Analogien aus den Bistümern Bamberg
und Würzburg (12) sprechen für slawische
Sprachlichkeit auf dem Lande, und mit den beiden Nennungen im Norden der
Oberpfalz auch in der Flednitz, noch im 13. Jahrhundert. Die erst seit
dem hohen Mittelalter erfolgende Ausweitung des bayerischen Dialekts bis
ins Fichtelgebirge und Egerland zeugt vom langen Prozeß bayerischer
Ethnogenese bzw. Assimilation der Slawen, (13) der
im Norden und an der nordöstlichen Peripherie, im Egerland und Teilen
Westböhmens auch später noch andauerte.
[Geschichte der Burg im Hochmittelalter]
Schriftquellen zur Entstehung der hochmittelalterlichen Burg auf dem
Gipfelplateau des Rauhen Kulms sind nicht bekannt. Die Nennung des
Leuchtenbergers Bucco de Culmen an erster Zeugenstelle in der
Stiftungsurkunde des Benediktinerklosters Michelfeld bei Auerbach von
1119 (14) weist zwar auf einen Ansitz, jedoch ist
unbekannt, ob sich dieser auf dem Rauhen oder Kleinen Kulm befand.
Erwogen wurde auch Identifizierung von Culmen mit dem Ort Kulmain
8 km nordnordöstlich vom Rauhen Kulm.(15)1281
verpfändete Landgraf Friedrich von Leuchtenberg das castrum Culme
an Burggraf Friedrich III. von Nürnberg, aus dessen Geschlecht die
hohenzollernschen Markgrafen von Ansbach-Kulmbach-Bayreuth hervorgingen.(16)
1370
erlaubte Kaiser Karl IV. dem Nürnberger Burggrafen Friedrich V, eine
Stadt zwischen den Vesten auf dem Rauhen und Kleinen Kulm zu gründen.
Die Burgen konnten von hussitischen Verbänden 1430 nicht eingenommen
werden, während Neustadt ein Raub der Flammen wurde. 1462 wurde Neustadt
im Fürstenkrieg von seinen Bürgern in Brand gesetzt, die dann in der
Burg auf dem Kleinen Kulm Zuflucht suchten. Anlaß war, dass Bayern bzw.
böhmische Söldner in markgräfliches Gebiet eingefallen waren, nachdem
Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg von Kaiser Friedrich die
Vollstreckung der Reichsacht über Herzog Ludwig den Reichen von
Bayern-Landshut und den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz übertragen
wurde. (17)
Über
das Aussehen der frühneuzeitlichen Anlage vermittelt die anläßlich von
Grenzstreitigkeiten angefertigte Göppmannsbühlkarte von 1531 (Abb. 4)
einen guten Eindruck.(18) Der durch den
zollernschen Markgrafen Albrecht Alcibiades von Kulmbach angezettelte
Markgrafenkrieg (1552-54) bedeutete das Ende beider Befestigungen. Nach
einjähriger Belagerung durch Truppen der Reichsstadt Nürnberg,
eindrucksvoll illustriert durch ein zeitgenössisches Flugblatt (Abb. 5),
mußte der Kommandant 1554, als Munition und Proviant erschöpft waren,
die Veste auf dem Rauhen Kulm übergeben. Die Burgen wurden daraufhin
gründlich geschleift und nicht wieder aufgebaut.
Die
beiden zeitgenössischen Darstellungen (Abb. 4-5) zeigen deutlich, dass
es für die Verteidigung unerläßlich war, stets über gute Sicht zu
verfügen und dem Angreifer keine Deckung zu geben, weshalb die
Berghänge, aber auch das weitere Vorfeld der Befestigung unbewaldet
waren. Das heute teils von wertvoller Vegetation geprägte Bild des
Rauhen Kulms steht dazu in großem Gegensatz.
Von der
Belagerung der Gipfelburg durch die Hussiten oder den
Auseinandersetzungen während des Fürstenkrieges zeugen vielleicht
Scherben spätmittelalterlicher Keramik, die im Torbereich des
frühmittelalterlichen Ringwalls, aber auch an anderen Stellen
angetroffen wurden, sowie zwei Armbrustbolzen (Abb. 6).
Archäologische Quellen des frühen bis hohen Mittelalters aus der
mittleren und nördlichen Oberpfalz sind in erster Linie Gräber (Abb.
25), Siedlungen und Burgen. Sie bestätigen, dass diese Region
vielschichtigen Prozessen ausgesetzt war, an denen Franken, Bayern,
Slawen bzw. Naabwenden und als wichtiger Traditionsträger auch die
namenlose autochthone Bevölkerung beteiligt waren.
Anmerkungen
(1) Fähnrich
1994.(siehe Literaturverzeichnis).
(2) Bayerische Vorgeschichtsblätter. Beiheft 5. 1992. Fundchronik für
das Jahr 1989: 58, Abb. 35;
(3) Eichler, Greule, Janka & Schuh 2006: 77-79, Schwarz 1960: 228-230,
389. Nordbayerische Beispiele sind Culm, Lkr. Coburg (Schwarz 1960:
229), Culmberg (heute Sophienberg), Lkr. Bayreuth (Eichler, Greule,
Janka & Schuh 2006: 79-80, 127, 251, 253, 262, 264, Schwarz 1960: 229),
Kolmberg, Lkr. Amberg-Sulzbach (Schwarz 1960: 229), Kollmitz, Lkr. Cham
(Schwarz 1960: 229), Kühlenfels (1326-1328 Kulmleins), Lkr. Bayreuth (Eichler,
Greule, Janka & Schuh 2006: 126-128, 251, 257, 262, 264, (5) Schwarz
1960: 229), Kulmain, Lkr. Tirschenreuth (Eichler, Greule, Janka & Schuh
2006: 59, 279, Häusler 2004: 70, Schwarz 1960: 229, 284), Kulmbach
(Schwarz 1960: 229-230), Kulmhof, Lkr. Schwandorf (Häusler 2004: 114,
Schwarz 1960: 229) oder Kulz, Lkr. Schwandorf (Schwarz 1960: 229).
(4) Schwarz 1960: 389, Verbreitungskarte Deckblatt 11.
(5) Schwarz 1960:230.
(6) Neubauer & Thieser 1995, 2001, Neubauer & Thieser 2007: Abb. 2
(7) Schwarz 1960: 195,
322.
(8) Brather 2001: 313-314.
(9) Wagner (Bearb.) 1952: 33-34; Neubauer & Thieser 1998: 53-54.
(10) Gradl (Hrsg.) 1886: Nr. 277, 101; Neubauer & Thieser 1998: 53-54.
(11) Lickleder 1995: Nr. 27, 13-14; Neubauer & Thieser 1998: 53-54.
(12) Guttenberg 1927: 39, Fußnote 185, Jacob 1982: 15-16.
(13) Herrmann, E. 1968.
(14) Monumenta Boica 1823: 546.
(15) Häusler 2004: 70.
(16) Gütter 1997: 133.
(17) Kunstmann 1965: 199-200
(18) Neubauer 2001.
Das
2002 ins Leben gerufene österreichischdeutsche Forschungsprojekt 'Die
Oberpfalz und ihre Nachbarregionen im frühen und hohen Mittelalter' des
Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien (Erik Szameit)
und des Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Hans Losert) hat sich die
Erforschung damit verbundener Fragestellungen zum Ziel gemacht.
(19)
Seit
Sommer 2004 finden nach 94 Jahren in diesem Rahmen auf dem Rauhen Kulm
wieder Ausgrabungen statt. (20) Es wurden fünf Stellen im Bereich der
unteren Umwehrung an der von Neustadt am Kulm abgewandten Ostseite
ausgewählt, (21) wobei gewährleistet war, dass die
Untersuchungen nicht Schäden an dem eindrucksvollen, bis zu 12,5 m
breiten und von außen teils noch 2 m hohen Wall anrichteten (Abb. 7).
Die Nordhälfte des Ringwalls aus mächtigen Basaltblöcken
durchschnittlich etwa 70 m unterhalb des Gipfels wurde im späten 19.
Jahrhundert bei der Anlage einer Rampe, dem Steinsträßl, zum Abtransport
von Basalt für den Straßen- und Schienenbau stark verändert und durch
einen tiefen Steinbruch am Osthang zerstört (Abb. 2). Ein Durchgang im
Süden geht vielleicht auf die Anlage eines Wanderpfads im 19.
Jahrhundert zurück, während das Zangentor im Osten alt ist.
[Aufbau des Ringwalles]
Der
innen senkrecht zum Wall (Abb. 7) angelegte Schnitt l unmittelbar an der
Südwange des Osttores zeigte, dass hier nur 4-5 m von der Wallinnenseite
entfernt, heute stellenweise unter besagtem Wanderweg, eine noch etwa l
m hoch erhaltene weitere Front verläuft, die möglicherweise zu einer
Pfostenschlitzmauer gehört (Abb. 8). Keramikfunde aus anschließenden
Schichten sprechen nach derzeitigem Kenntnisstand für Entstehung im 5.
vorchristlichen Jahrhundert (siehe den Beitrag von Gabriele Raßhofer in
diesem Band). Eine 2007 begonnene großflächige Schnitterweiterung im
Bereich des ehemaligen Ringwanderwegs, wo neben zahlreichen
vorgeschichtlichen Scherben und drei Pfeilspitzen aus Flint in ganz
geringer Tiefe ein silberner Schläfenring mit S-Schleife, möglicherweise
stumpfem Reifende und einer aufgeschobenen Holzperle [Abb. 9]
(22) wohl des 9. Jahrhunderts angetroffen wurde, soll die
Abfolge und Bedeutung der hier recht komplizierten Befunde endgültig
klären.
Schnitt
2 galt 2004 der Untersuchung eines etwa halbkreisförmigen Podests direkt
am Fuß des Geröllkegels gegenüber der Nordwange des Osttores (Abb. 10).
Die zahlreichen, teils gestaffelten Podeste im schmalen Streifen
zwischen Schuttkegel und Ringwall im Süden, Südosten und Osten [Abb. 2]
(23) sind am ehesten Fundamente
frühmittelalterlicher Holzbauten, nahe am Tor boten sie zusätzlich
Schutz des Zugangs. Ähnliche Strukturen allerdings aus
vorgeschichtlicher Zeit finden sich etwa im Bereich der Befestigung auf
dem Basaltmassiv des Schafberges bei Löbau in der Oberlausitz.
(24)
Die
Nordhälfte des 300 m durchmessenden Ringwalls durchschnittlich etwa 70 m
unterhalb des Gipfels wurde im späten 19. Jahrhundert bei der Anlage
einer Rampe zum Abtransport von Basalt für Straßen- und Schienenbau
stark verändert und durch einen tiefen Steinbruch am Osthang zerstört
(Abb. 2). Zur Vorbereitung einer Erweiterung wurde der Wall auf etwa 35
m Länge abgetragen, kurz bevor die Basaltgewinnung endgültig eingestellt
wurde. Hier bestand die Hoffnung, dass ohne großen Aufwand, den ein
Schnitt (Schnitt 3) durch die erhaltene Umwehrung erfordert hätte, deren
Struktur rekonstruiert werden könne. Ein dichtes Netz aus starken
Wurzeln und schweren verlagerten Basaltblöcken verhinderte jedoch die
rasche Freilegung archäologischer Befunde. Erst unmittelbar vor Abschluß
der Kampagne 2005 bestätigte sich die Vermutung, das im Ringwall eine
zweifrontige Trockenmauer steckt (Abb. 11). Für die mittlere und
südliche Oberpfalz typische im Randbereich nachgedrehte Goldglimmerware
sowie rauwandige Scherben mit Quarzsand und weniger deutlichen
Glimmeranteilen (Abb. 13-14), darunter auch eindeutig slawische Keramik,
datieren diese ins 8. bis 10. Jahrhundert. Dazu kommt der Rest eines
eisernen Sporns und ein Hufeisen (Abb. 15) der ersten Hälfte des 10.
Jahrhunderts mit zahlreichen Analogien etwa von der ungarnzeitlichen
Umwehrung auf dem Runden Berg bei Urach, Lkr. Reutlingen am Nordwestrand
der Schwäbischen Alb. (25)
Am
Ringwanderweg oberhalb des Wallschnitts zeigte sich in einer
verhältnismäßigen großen einigermaßen ebenen Fläche (Schnitt 5), dass
auch hier zwar zahlreiche Funde der Vorgeschichte und des frühen (Abb.
12, 14) bis späten Mirtelalters (Abb. 6) zu erwarten sind, neben dem
rezenten Waldhumus und einem Verwitterungs bzw. Mischhorizont über dem
anstehenden, natürlich gewachsenen Boden aber kaum Kulturschichten zu
differenzieren sind. Die sonst für intensiv genutzte Plätze häufigen
Siedlungsgruben konnten hier bislang nicht festgestellt werden, so dass
sowohl während der Vorgeschichte als auch im frühen Mittelalter bis ins
10. Jahrhundert mit Blockbauten, die im Boden kaum Spuren hinterließen,
zu rechnen ist.
Die
frühmittelalterliche Hangmauer wurde spätestens um 900 durch eine
mächtige Anschüttung von Basaltblöcken gegen die Vorderfront in einen
breiten Wall umgewandelt, wobei möglicherweise zunächst auch ein
Abrutschen der Vorderfront verhindert werden sollte. Die zeitliche
Einordnung stützt die Beobachtung in Schnitt 4, dass in vorgelagerten,
den Weg zum Tor begleitenden bogenförmigen Terrassen (Abb. 2)
gestaffelte Annäherungshindernisse stecken, wie sie typisch für
Befestigungen der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts gegen die Ungarn
sind. (26) 948 siegte der bayerische Herzog
Heinrich I. (* um 920, 948 Herzog, + 955) über die Ungarn, die neuen
Nachbarn der Bayern im Südosten, bei Floß in Nordgowe, 949 folgte
eine Niederlage an der Luhe, (27) Die Ereignisse -
nur etwa eine Tagesreise vom Rauhen Kulm entfernt - betonen die
strategische Bedeutung der Fernwege in der nördlichen Oberpfalz und
zeigen, dass es hier für die Ungarn durchaus etwas zu holen gab.
Als
Bauherren für diesen Wall, dessen Errichtung einen erheblichen
Arbeitsaufwand darstellte, zumal dazu ja auch noch für die Verteidiger
auf der Wallkrone hölzerne Laufgänge und eine Brustwehr gehört haben
mußten, kommen am ehesten die Schweinfurter Markgrafen in Frage.
(28) Es würde sich dann neben der Anlage von
Bayreuth-Laineck um deren am weitesten im Nordosten gelegenen Stützpunkt
handeln, (29) falls nicht auch die Burg zu Eger
(30) in deren Besitz war. Träfe letzteres zu, dann
wären diese Befestigungen zumindest im 10. Jahrhundert Bestandteile
einer nordbayerischen Mark gegen Böhmen, (31) in
der der Landesausbau überwiegend von Slawen getragen wurde.
[Eine wichtige Landmarke]
Der
Rauhe Kulm bildete wie andere markante Gipfel, etwa des Parksteins, wohl
in allen Menschheitsepochen einen wichtigen Orientierungspunkt für
Menschen, die auf Mobilität im weitesten Sinne angewiesen waren. Die
Lage der Landmarke an bis in die Gegenwart genutzen Fernwegen,
(32) etwa vom Donaugebiet um Regensburg nach
Mitteldeutschland oder ins Obermaingebiet, aber natürlich auch von
Westen über das Egerland oder Pilsen nach Böhmen steht damit in
unmittelbarem Zusammenhang.
Noch zu
klären ist, in welche Zeit die in allen Sondagen vor allem aber in
Schnitt 4 an einem der Annäherungshindernisse vor dem Tor angetroffenen
Eisenschlacken (33) gehören, wann das
Gipfelplateau, wo Reste von Trockenmauern durchaus für frühe
Zeitstellung sprechen, erstmals befestigt wurde und wie die Entwicklung
hin zur wahrscheinlich 1119 erstmals genannten und 1554 zerstörten
Gipfelburg verlief. Die Grabungen werden daher fortgesetzt. (34)
Anmerkungen -2
(19) Lehrgrabungen
fanden bislang in einer frühslawischen Siedlung bei Dietstätt, Lkr.
Schwandorf (2002, 2005, 2006, 2007), in der Nekropole von Mockersdorf
(2003, 2004) und im Bereich des Ringwalls am Rauhen Kulm (2004, 2005,
2006, 2007) statt.
(20) Losert 2006: 60-61, Losert 2007, Losert & Szameit 2005, Raßhofer
2007.
(21) Stroh 1975: 228-229, Beilage 8.
(22) Derartige aufgeschobene Perlen aus organischem Material sind sehr
selten nachzuweisen; bedingt vergleichbare Ringe aus der
Völkerwanderungs- und Merowingerzeit bildet Quast (2000: Abb. 5) ab.
(23) Neischl 1912:
Planbeilage II, Stroh 1975: Beilage 8.
(24) Gerlach 2008: Abbildung S. 68 (freundlicher Hinweis Norbert
Hübsch, Bayreuth), Gerlach & Simon 1989: Abb. 1.
(25) Koch 1984: Taf. 13-14, Taf. 15; 1-16.
(26) Ettel 2001: 206-207.
(27) Reindel 1981: 292, Schuster 1990: 50-51.
(28) Ettel 2001: Abb. 84, Schneider & Schneidmüller (Hrsg.) 2004.
(29) Abels& Losert 1986.
(30) Hejna 1967, 1968, 1971, Nitz 1991, Stloukal, Szilvässy & Sebesta
1988.
(31) Den Beziehungen zwischen Nordostbayern und dem Egerland soll sich
ein für 2009 geplantes archäologisches Symposium des Lehrstuhls für
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg sowie des Instituts für Vor- und
Frühgeschichte der Karls-Universität Prag widmen.
(32) Dollacker 1938, Emmerich 1955, Manske 2003, siehe besonders Häusler
2004: Abb. 8.
(33) Bei frühhochmittelalterlicher Zeitstellung wäre ein Zusammenhang
mit der eindrucksvollen Pingenreihe der 10 km vom Rauhen Kulm entfernten
Bärenlöcher nordöstlich von Speichersdorf nicht auszuschließen.
(34) Die archäologischen Untersuchungen am Rauhen Kulm wären ohne die
großzügige Unterstützung durch viele historisch interessierte Personen
und zahlreiche örtliche und überregionale Institutionen nicht möglich
gewesen. Allen Helfern und Gönnern gilt an dieser Stelle unser
herzlicher Dank. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die
Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis,
die im Rahmen ihres von der Europäischen Union geförderten
grenzübergreifenden Projektes „Siedlung - Sprache - Straße.
Siedlungsgeschichte in der Euergio Egrensis" die Grabung am Rauhen Kulm
überhaupt erst möglich gemacht hat.
[Hans Losert in: Neubauer, Michael und Thieser, Bernd:
Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm in der Flednitz: 65-87. In:
Kemnath 1000 Jahre ... und mehr (Heimatbuch zum 1000-jährigen Bestehen)
2007 - Zwischenüberschriften vom Bearbeiter]

Hans Losert bei einer Führung: 26.08.2005 [Foto: D. Sch.]
|
|
=>
Weiter zum 2. Teil 2006/2007
[zurück
zur Übersicht]
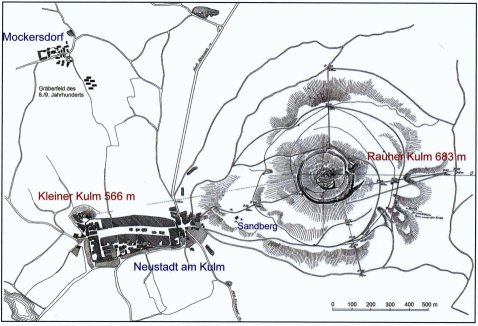
Abb. 1: Neustadt mit dem Rauhen Kulm im
Osten und dem
Kleinen Kulm im Westen sowie Mockersdorf mit der slawischen
Nekropole des 8./ 9. Jahrhunderts. [nach Neischl 1912: Planbeilage I]
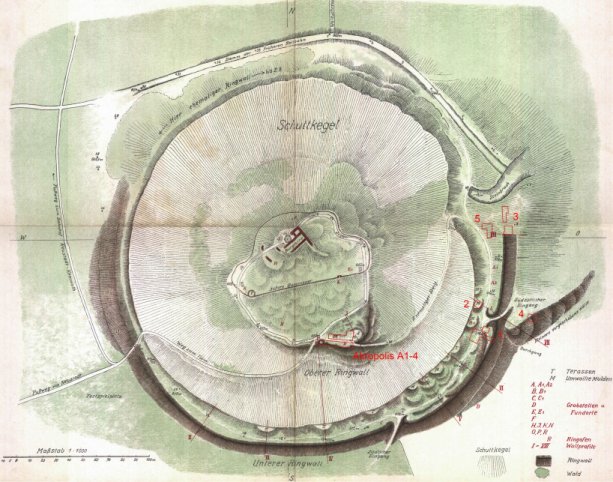
Abb. 2: Rauher Kulm, Plan der
Befestigungen
[Neischl 1912: Planbeilage II - Hans Losert]
rot eingezeichnet: Nr. der Grabungsschnitte
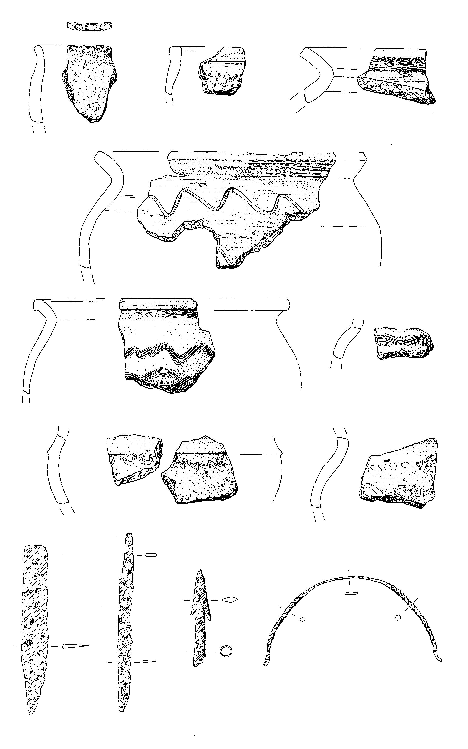
Abb. 3: Rauher Kulm. 1-12 Fundauswahl der Grabungen
von
Adalbert Neischl 1908-1910. 1 Vorgeschichte oder
frühes Mittelalter,
2-12 frühes Mittelalter. 1-8 Keramik,
9-12 Eisen. M 1 : 2.
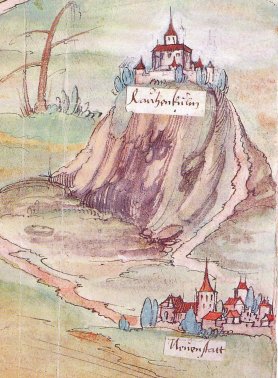
Abb. 4: Älteste bekannte Darstellung des Rauhen Kulms
mit der
zollernschen Burg. Deutlich zu erkennen ist ein
zentraler Turm,
davor
ein größeres Gebäude sowie eine
Mauer mit bastionsartigen
Türmen und am
Fuß des überhöhten Bergkegels Neustadt am Kulm. Ausschnitt aus der
anläßlich
von Grenzstreitigkeiten zwischen den
Mark- und Pfalzgrafen
angefertigten Göppmannsbühlkarte von 1531 [Neubauer 2001, Staatsarchiv
Bamberg, A 240 Karten und Pläne, Nr.107R].
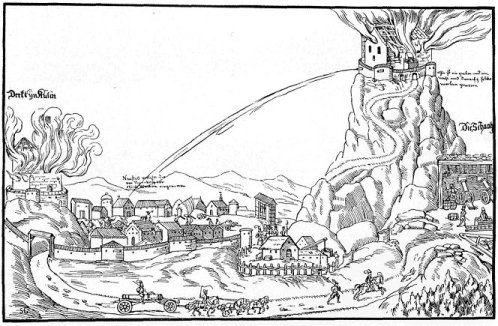
Abb. 5: Belagerung der markgräfl. Veste auf dem Rauhen Kulm
durch Truppen der Reichsstadt Nürnberg im Jahre 1554, links (westlich)
Neustadt am Kulm und die Burg auf dem Kleinen Kulm. Zeitge-
nössischer Nürnberger Holzschnitt. [Aus Neischl 1912, Abb. 4].
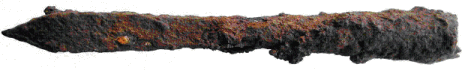

Abb. 6: Rauher Kulm, Kampagne 2006.
Armbrustbolzen wohl des 15. Jahrhunderts aus dem Waldhumus nahe der
Wallinnenseite
(Schnitt 5). [Foto: Hans Losert]

Abb. 7: Kampagne 2004. Blick nach Osten
auf die Umwehrung
von der Innenseite (Schnitt 1).
[Foto: Hans Losert]

Abb. 8: Kampagne 2004. Blick nach Westen
auf die Vorderfront der inneren, vielleicht vorgeschichtlichen
Mauerfront (Schnitt 1).
[Foto: Hans Losert]
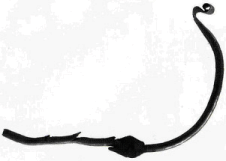
Abb. 9: Kampagne 2007. Silberner
Schläfenring (Reifdurchmesser ursprünglich 5,5-6 cm, unrestauriert) wohl
des 9. Jahrhunderts mit aufgeschobener Holzperle (Schnitt l, Erweiterung
2007).
[Foto: Hans Losert]

Abb. 10: Kampagne 2004. Blick nach Westen
auf das Podest für einen Holzbau am Fuß der Blockhalde direkt am
Zangentor (Schnitt 2).
[Foto: Hans Losert]
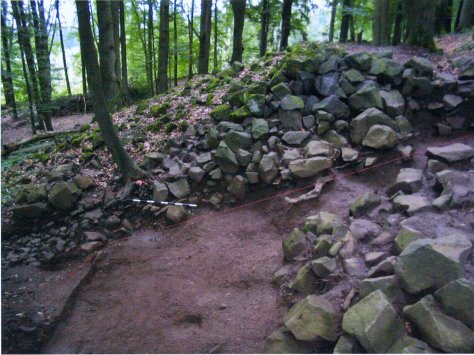
Abb. 11: Kampagne 2006. Profil durch den
unteren Ringwall; deutlich zu erkennen ist die zweifrontige Trockenmauer
im Kern und die von außen erfolgte Wallschüttung. [Foto: Hans Losert]

Abb.
12: Kampagne 2004-2006. Keramik des 8./9. Jahrhunderts aus der von innen
an die Trockenmauer anstoßenden Kulturschicht (Schnitt 3). Maßstab = 5
cm.
[Foto: Hans Losert]

Abb. 13: Kampagne 2004 - 2006, Keramik
des 8./9. Jahrhunderts aus der im Innern an die Trockenmauer anstoßenden
Kulturschicht (Schnitt 3) oberhalb des Wallschnitts 3. Maßstab = 5
cm.
[Foto: Hans Losert]
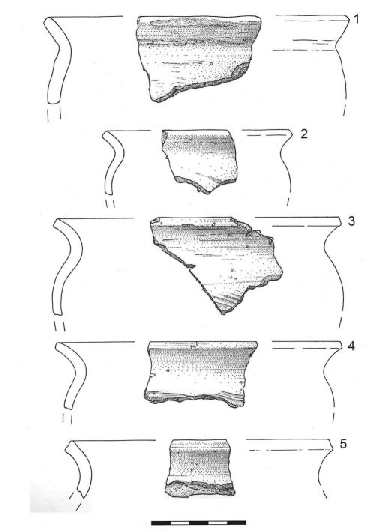
Abb. 14: Kampagne 2006. Keramik des
8./9. Jahrhunderts
aus Schnitt 5 oberhalb des Wallschnitts 3.
[Zeichnung: Hans Losert]
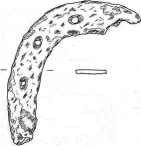
Abb. 15: Kampagne 2004. Hufeisen (Länge
10 cm) der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts aus dem zerstörten
Wallbereich (Schnitt 3). [Zeichnung: Hans Losert]
=>
Luftbilder vom Rauhen Kulm
=>
Weiter zum 2. Teil 2006/2007
[zurück
zu den Ausgrabungen
am Rauhen Kulm 2003]
[zurück
zur Übersicht]

Rauher Kulm, Wall mit Toranlage, von außen gesehen
[Foto: K. Graf] |
![]() nach oben [home]
Dieter Schmudlach - 10.02.08.2010/14.09.2010
nach oben [home]
Dieter Schmudlach - 10.02.08.2010/14.09.2010