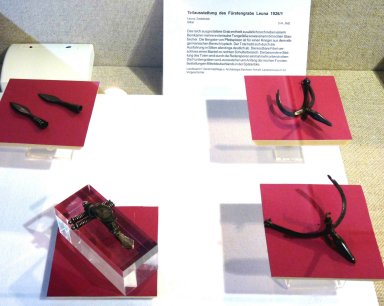Prunkvoll ausgestattete Fürstengräber
Über der
Kriegerelite hebt sich in den Fürstengräbern Mitteldeutschlands
zumindest regional eine weitere herrschaftliche Elite ab. Diese
zeichnet sich neben Waffenbeigaben durch allerlei römischen Prunk,
seien es Möbel, Edelmetallgefäße o. a. aus. Ein zusätzliches
entscheidendes Merkmal dieser elitären Gruppe ist Reitzubehör in
Form von Sporen, die ansonsten in den Kriegergräbern fehlen. Erst
gegen Ende des 5. Jahrhunderts werden Sporenfunde zahlreicher.

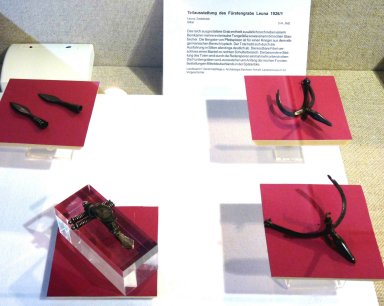 Abb. 2/3
Abb. 2/3
Teil der Ausstattung aus dem Fürstengrab
von Leuna 1926/1
Das reich ausgestattete Grab enthielt zusätzlich noch neben
einem Beinkamm mehrere römische Tongefäße sowie einen römischen
Glasbecher. Die Beigabe von Pfeilspitzen ist für einen
Krieger aus dem elbgermanischen Bereich typisch. Der Tote hebt
sich durch die Ausführung in Silber allerdings deutlich ab Die
kostbare Fibel verschloss einen Mantel im rechten Schulterbereich.
Die besondere Stellung des Toten wird durch die Reitersporen
einmal mehr unterstrichen. Die Fürstengräber von Leuna
stehen am Anfang der reichen Fürstenbestattungen Mitteldeutschlands
in der Spätantike.
[Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für
Vorgeschichte]
Teile der Ausstattung des Fürstengrabes
von Leuna, Saalekreis, 1917/2
Dieses Fürstengrab enthielt zusätzlich noch einen goldenen
Fingerring, einen Kamm, mehrere römische Tongefäße sowie eine
Silberschale, eine Bronzekelle mit Sieb sowie Teile einer
Glasschale. Die Münze des Kaisers Tetricus (gallisches
Sonderreich) datiert das Grab an das Ende des 3./Anfang des 4.
Jahrhunderts.
[Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie
Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte]
Das Grab von Wolfsheim (Rheinhessen):
1. Hälfte 5. Jhdt.
Die bereits im 19. Jhdt. beim Pflügen entdeckten Funde belegen, dass
es sich bei dem Grab um einen der bedeutendsten und reichsten
Grabfunde Mitteleuropas handelt. Der massiv goldene Armring
kennzeichnet den Bestatteten als ranghohe germanische
Führungsperson. Die goldene Fibel diente dem Verschluss eines
Mantels nach römischem Vorbild. Auch der Halsring ist als römische
Militärinsignie zu werten. Der Anhänger, vermutlich am Halsring
getragen, ist ein Altstück. Er trägt auf der Rückseite in Persisch
eingraviert den Namen des Gründers der Sasanidendynastie.
Möglicherweise brachte der Bestattete das Schmuckstück aus
Persien mit, als er dort in Diensten der römischen Armee an einer
Auseinandersetzung gegen die Sasaniden teilgenommen hatte.
– Für die Herstellung des Goldschmuckes waren umgerechnet
ca. 100 Solidi (Goldmünzen) von Nöten. Zusätzlich enthielt das
Grab einen 364/7 geprägten Goldsolidus.
 Abb. 7
Abb. 7
 Abb. 8
Abb. 8
Goldene Fibel als
Mantelverschluss
Der mit Almandineinlagen verzierte
Anhänger
stammt aus Persien und ist etwa 100 Jahre älter
als die übrigen Beigaben. Auf der Rückseite ist
in der Pahlevi-Schrift „Ardaschir“ eingraviert.
Prächtige Gürtel auch für einen Fürsten
Kerbschnittverzierte
Gürtelbeschläge, zumeist aus Bronze, sind typische Bestandteile
der spätrömischen Militärtracht. Die punzverzierten
Schnallen und sonstige Beschläge waren auf breiten Ledergürteln
aufgenietet. Derartige Gürtel trugen römische Legionäre. An
diesen oft reich verzierten Gürteln (cingulum) hingen die Schwerter,
Dolche und oftmals eine lederne Tasche, die Kleinutensilien wie
Toilettebestecke und Feuersteine enthielt. Die Gürtel
waren so charakteristisch, dass sie den Soldaten kennzeichneten,
auch wenn er keine Rüstung trug. Zahlreiche Bestandteile dieser
Militärgürtel sind auch weit jenseits der römischen Grenze in
germanischen Siedlungen und Gräbern zu finden. Sie weisen
darauf hin, dass ihre Besitzer ursprünglich dem römischen Heer
als Söldner in den Auxiliartruppen dienten. Nach ihrer
Dienstzeit nahmen sie die Rangabzeichen in ihre Heimat mit. Im
Inneren Germaniens waren diese Gürtel so sehr begehrt, dass sie
sogar nachgemacht wurden.
Trinkfreudige Germanen (?)
 Abb. 10
Abb. 10
Trinkhorn (Nachbildung)
Mannheim-Feudenheim Grab 2 Eisen und Holz - 1. Jhdt.
In der frühen Kaiserzeit finden sich des öfteren Beschläge von
Trinkhörnern in den Gräbern. Das eigentliche Gefäß, meist
aus Horn oder Holz gefertigt, hat in der Regel nicht überdauert.
Tacitus zu Folge waren die Germanen trunksüchtig, doch sind
Funde von Trinkhörner bislang in germanischen Gräbern
vergleichsweise weniger häufig als Waffen. Hingegen wurden in
einer einzigen römischen Villa am Vesuv mehr silberne Trinkgefäße
gefunden als im gesamten germanischen Gebiet.
[Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim]
=>
Die
Grabausstattung des Germanenfürsten von Gommern
=>
Bilder von der Sonderausstellung:
Handwerker - Krieger -Stammesfürsten" im
Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld
in einem PICASA-Webalbum
=>
[Zurück zur Übersicht]
=> [zurück
zum Reisberg -1-]
=>
[Zurück zur
Völkerwanderungszeit]
![]() nach oben [home]
Alle Fotos : D. Sch Dieter Schmudlach
(D. Sch.):
8.06.2010/18.09.2010
nach oben [home]
Alle Fotos : D. Sch Dieter Schmudlach
(D. Sch.):
8.06.2010/18.09.2010