|
Johannes Kaulfuß - ein
anerkannter Insektenforscher
Im Landschaftsmuseum Obermain auf der Plassenburg
ist ein großer Raum allein dem Kulmbacher Naturforscher Johannes Kaulfuß
(1859-1947) und seiner einzigartigen Sammlung insbesondere von
Schmetterlingen, Spinnen, Skorpionen und Käfern aus aller Welt gewidmet.
Die Besucher sind beeindruckt von dieser sehenswerten Exhibition, die
von der Kulmbacher Wissenschaftlerin Dr. Eleonore Hohenberger
vorbereitet und aufgebaut wurde. ...
„Die älteren Bürger erinnern sich noch des spitzbärtigen alten Herrn mit
den klugen, lebhaften Augen und dem energischen Gesicht, das kaum ahnen
ließ, was für ein unendlich gütiger Mensch Johannes Kaulfuß sein
konnte." Mit diesen Worten beschrieb der frühere Heimatforscher,
Kulturreferent und Oberstadt-schulrat Max Hundt den Wissenschaftler, der
1928 seiner Vaterstadt eine inner-halb von 50 Jahren bei Expeditionen
rund um den Erdball zusammengetragene, aus 27 000 Schauobjekten
bestehende Sammlung vermacht und damit den Grundstein für ein
Naturwissenschaftliches Museum auf der Plassenburg gelegt hatte.
Kindheit und karge Jugend
Geboren wurde Johann Simon Kaulfuß am 17. Juli 1859 in Culmbach im Haus
mit der Nummer 210 (Festungsberg 11) als Sohn des Tünchers Karl Philipp
Kaulfuß und seiner Ehefrau Johanna Rosina, geborene Felbinger. Die
Kaulfuß stammten aus der Rheinpfalz. Georg Philipp Kaulfuß, der
Großvater von Johann, musste als Pfälzer unter Napoleon 1. den Feldzug
nach Russland mitmachen und ließ sich dann 1816 in Kulmbach nieder, wo
er als Drechsler tätig war. Sein Sohn Karl Philipp war kein einfacher
Tüncher, sondern ein gelernter Dekorationsmaler, der Arbeiten in den
Schlössern Thurnau, Wernstein und Guttenberg ausführte. Er starb schon
1868, so dass der gerade neun Jahre alte Johann zu seinen Großeltern
kam.
In dem aufgeweckten Jungen waren inzwischen bereits die Freude an der
Natur und ein gewisser Forschungsdrang erwacht. Schon in seinen
Kinderjahren bat er seine Mutter immer wieder, mit ihm auf die Wiesen zu
gehen, wo er Blumen pflückte und von seiner Mutter deren Namen wissen
wollte. Als er 1866 in die Volksschule kam, waren Naturkunde und
Geographie seine Lieblingsfächer. Im 9. Lebensjahr sammelte und
präparierte er bereits Pflanzen aus seiner Umgebung und legte sich ein
Herbarium an. Von den wenigen ersparten Groschen kaufte er sich das Buch
„Führer in der Pflanzenwelt", so dass er seine Funde bald auch mit den
wissenschaftlichen, lateinischen Namen bezeichnen konnte.
Laufbursche und Schustergeselle
Nach der Schulentlassung 1873 entschied seine Großmutter, dass er nun
selbst sein Brot verdienen müsse. Zunächst kam er als Laufbursche in die
damalige Pulvermühle, obwohl er selbst am liebsten Förster oder Lehrer
geworden wäre. Nach einem Unfall in der Pulvermühle, als er der dortigen
Transmission zu nahe gekommen war, wollte er seinen eigenen Berufswunsch
in die Tat umsetzen, doch die Großmutter erklärte ihm, dass eine
Handwerkslehre das beste für ihn wäre. Solche Versuche scheiterten
jedoch sowohl bei einem Schreiner - als auch bei einem Schlossermeister,
weil das von diesen verlangte Lehrgeld nicht bezahlt werden konnte.
Darauf verschaffte ihm die Großmutter eine Stelle im damaligen Gasthof
„Zum Hirschen" (Langgasse), jedoch war der oft bis drei Uhr früh
dauernde Dienst so anstrengend, dass der Junge vor Schwäche sogar
umfiel. Seine Mutter vermittelte ihm dann endlich eine Lehrstelle bei
einem Onkel, und zwar dem Schuhmachermeister Hans Müller in der Oberen
Stadt. Obwohl er den Beruf des Schusters eigentlich gar nicht mochte,
wurde aus Johannes ein sehr brauchbarer Geselle, der es besonders gut
verstand, „Pariser Absätze" für die Frauenschuhe zu fertigen, so dass
ihn die weibliche Kundschaft ganz besonders bevorzugte. Trotz der langen
Arbeitszeit, die oft schon früh um 4 Uhr begann und bis in die späten
Nachtstunden dauerte und auch den Sonntagvormittag umfasste,
setzte Kaulfuß seine Beobachtungen und Forschungen in der Pflanzenwelt
fort.
Erste Forschungen in der Pflanzenwelt: Farne und Moose
Die von ihm gepressten Blumen und Pflanzen wurden ihm häufig von
Präparandenschülern abgekauft, bis ein Lehrer diesen Handel mit der
Begründung verbot: „Ich verbiete euch, dass ihr mit Schuster und
Schneider verkehrt."
Der junge Schustergeselle sah sich bald in die Lage versetzt, eine
botanische Zeitschrift zu abonnieren. Darin fand er mehrmals Inserate,
durch die Lehrmittel oder Herbarien gesucht wurden. Das brachte ihn auf
die Idee, selbst Angebote zu veröffentlichen. Und in der Tat gingen
Bestellungen ein, so dass er fortan Lehrmittelhandlungen, später sogar
Museen und Universitäten, mit präparierten Gräsern und Farnen
belieferte. Vom 18. Lebensjahr an spezialisierte er sich auf die
schwierigeren Pflanzenfamilien, verlegte seinen Lerneifer auf die Gefäß-kryptogamen (Farne). Sein Steckenpferd wurde schließlich das
Gebiet der Byrologie (Mooskunde), das ihm weltweite Berühmtheit bringen
sollte. Im Laufe der Jahrzehnte trug er eine Sammlung von etwa 10000
verschiedenen Moosen zusammen, 32 von ihm entdeckte Moosarten wurden von
der Wissenschaft nach Kaulfuß benannt. Darüber hinaus eignete er sich
die Fertigkeit an, Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten zu
präparieren und die gesammelten Stücke nach Arten zu bestimmen. Soweit
ihm das nicht möglich war, wandte er sich an Universitätsinstitute, die
ihm bereitwillig Auskunft gaben.
Verkauf von Schuhen und
naturkundlichem Anschauungsmaterial
Der Militärdienst, den er von 1879 bis 1882 in Bayreuth ableistete,
unterbrach Sammlertätigkeit und Selbststudium. Das Angebot, bei den
Soldaten zu bleiben, lehnte er aber ab, weil er fortan noch mehr
wissenschaftlich arbeiten wollte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er
sich durch einen Schuhhandel, den er in Michelau aufzog, sowie durch den
Verkauf naturkundlichen Anschauungs-materials. Letzterer entwickelte sich
nicht nur bestens, sondern machte ihn auch weit über Deutschland hinaus
bekannt. So hatte er bald Kontakt zu den natur-wissenschaftlichen
Instituten in Stockholm, Washington, Tokio, Sydney und Melbourne, und
auch namhafte Gelehrte im In- und Ausland wurden auf ihn aufmerksam.
1885 heiratete er in Michelau Kunigunda Knab aus Limmersdorf und verzog
mit ihr wenig später nach Nürnberg, wo er durch seinen Handel mit
verschiedenen Sammlern, vor allem aber durch seine Kontakte mit der
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, vielfältige Beziehungen aufbaute.
Durch die Bekanntschaft mit namhaften Persönlichkeiten wurde er am
städtischen Schlachthof als Trichinen-beschauer angestellt, wodurch er
seine wirtschaftliche Grundlage erheblich verbessern konnte. 1903
gründete er den Botanischen Tauschverein Nürnberg, der mit ihm als
Geschäftsführer bald 400 Mitglieder in aller Welt zählte.
Lang ersehnte Forschungsreisen
In diesen Jahren konnte er auch an die Verwirklichung der schon längst
ersehnten großen Forschungsreisen denken, weil seine Frau unterdessen
den Tauschhandel weiterführte. Die erste Reise führte ihn nach
Österreich-Ungarn und Sieben-bürgen, dann in die Karpaten und nach
Griechenland, wo er hauptsächlich auf dem Taygetes wertvolles Material
fand. Bei der zweiten im Jahre 1884 suchte er gemeinsam mit einem
Freund, dem Liebhaber-Sammler Sintenis aus Breslau, das transkaspische
Gebiet auf. Schlimme Zeiten erlebten die beiden unter den wilden
Kurdenstämmen. So verließen sie diese ungastliche Gegend und wanderten
ins südliche Nordpersien. Solch ein Gebiet hatte sich Kaulfuß gewünscht:
Die botanische Ausbeute war glänzend. Über Syrien, Nordafrika, die
Kanarischen Inseln und die Pyrenäen kehrte er wieder in die Heimat
zurück.
Hatte Kaulfuß diese Reisen aus dem Verkauf der Funde selbst finanziert,
so erhielt er für seine weiteren Expeditionen Zuschüsse, u. a. von den
Universitäten Washington, Sydney und Melbourne. Die nächste große Reise
ging über den Ozean ins obere Amazonasgebiet, die „grüne Hölle". Dieses
Unternehmen war, wie aus einer im Jahre 1937 erfolgten Veröffentlichung
hervorgeht, mit ungeheuren Strapazen verbunden: „Von Pernambuco aus
drang Kaulfuß in den Urwald ein. Unter unsäglichen Schwierigkeiten oblag
er seiner Sammlertätigkeit. Blumen, Farne, Moose - meist noch unbekannte
Arten - und Kleintiere, unter ihnen Tausende herrlicher
Tropenschmetterlinge, wurden gleichermaßen zusammengetragen. In einer
Hitze von 40 bis 45 Grad, von wilden Tieren und unheimlichen Schlangen
umlauert, von Affen belästigt, umtost vom Radau der Zykaden, dem
Geschrei der Brüllaffen, dem Gekreisch der Papageien und dem Gequake der
Sumpffrösche, vollbrachte Kaulfuß sein Tagewerk. Er streifte von
Siedlung zu Siedlung, lag sechs Wochen mit zerbrochener Kniescheibe in
einem Indianerwigwam, ließ sich von den Indianern pflegen und heilen und
stürzte sich dann wieder von neuem mit wahrem Fanatismus in die
Arbeit..." Seine weiteren Expeditionen führten den Forscher in viele
andere Länder, so unter anderem nach Ost-Java, Mexiko, Tibet, Indien,
Ägypten, Australien und Vorderasien. Mit zeitweiligen Unterbrechungen
dauerten diese Reisen bis zum Jahre 1911. Während dieser Zeit brachte
Kaulfuß auch für sich selbst so ungeheure Mengen an Pflanzen und
Insekten aus allen Erdteilen mit, dass er sich eine Sammlung anlegen
konnte, wie sie - nach dem Urteil von Experten - „in solcher
Vollständigkeit selten anzutreffen ist".
Zwischen den großen Forschungsreisen war Kaulfuß nicht müßig. Er
benützte diese Zeiten zur Auswertung des neuen Materials. In Fachkreisen
sicherte man sich bald die Mitarbeit dieses Mannes, der sich als
Autodidakt ein enormes Wissen angeeignet hatte. Bereits 1888 berief ihn
die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg als Mitglied und übertrug ihm
den Posten des Kustos für die Krypto-gamischen Sammlungen. Mit den
bedeutendsten Forschern stand Kaulfuß in Briefwechsel, Material- und
Wissensaustausch pflegte er mit Museen und Universitäten in aller Welt.
Zudem war er an der Herausgabe berühmter botanischer Werke beteiligt.
Rückkehr nach Kulmbach
Am 12. Oktober 1899 verlor Kaulfuß seine Frau Kunigunda. Die fünf aus
dieser Verbindung stammenden Kinder waren der Mutter im Tod schon
frühzeitig vor-ausgegangen. Am 24. November 1900 heiratete er zum zweiten
Mal, diesmal Margareta Faatz aus Erlau bei Bamberg. Diese Ehe blieb
kinderlos, seine zweite Frau verstarb am 11. März 1938 in Kulmbach.
Inzwischen war Johannes Kaulfuß in den Ruhestand getreten und lebte
sechs Jahre in Bayreuth, bevor er 1928 wieder nach Kulmbach
zurückkehrte. Er machte seine naturwissenschaftliche Sammlung mit rund
27000 Schauobjekten vom kleinsten heimatlichen Kerbtier bis zum
herrlichsten Tropenschmetterling sowie zahlreiche Zeichnungen, auf denen
er Hunderte von Pflanzen und Tieren in naturgetreuen Aquarellen
festgehalten hatte, seiner Vaterstadt zum Geschenk, die sie auf der
Plassenburg zur Ausstellung brachte. Mit hingebungsvoller Liebe führte
der Wissenschaftler selbst dort rund 15 Jahre lang die Freunde der Natur
in die geheimnisvolle Schönheit ein, die aus jedem seiner Schaustücke
sprach.
Zerstörung seines Lebenswerkes
Die Sammlung auf der Plassenburg wurde nach Kriegsende 1945 von dort
ein-quartierten und von den Amerikanern befreiten polnischen
Zwangsarbeitern in einer Mischung aus Rachedurst und Siegestaumel
weitgehend zerstört. Beherzten Kulmbachern gelang es zwar, 98
Schaukästen zu retten, doch brach die Vernichtung seines Lebenswerkes
Kaulfuß das Herz. „Tief bedrückt von der Not, in die unser Vaterland
geraten war", so schrieb Max Hundt, starb Kaulfuß am 15. Februar 1947 im
Alter von 87 Jahren im Kulmbacher Bürgerspital.
Die neue Kaulfußsammlung
Aus den Resten wurde 1957 eine neue Kaulfußsammlung aufgebaut, die nach
langwierigen und umfangreichen Restaurierungsarbeiten jetzt im
Landschafts-museum Obermain in neuem Glanz entstanden ist. Die
Wissenschaftlerin Dr. Eleonore Hohenberger tat dies nicht nur mit großer
Sachkenntnis, sondern auch mit Engagement und viel Liebe im Detail,
wobei sie freilich nur etwa ein Fünftel der noch vorhandenen Stücke
unterbringen konnte, die restlichen Kästen lagern im Depot. Dr.
Hohenberger will diese Ausstellung nicht nur als alltägliche Exposition,
sondern auch als Reminiszenz an den Forscher Kaulfuß („Seine größte
Stärke war seine geradezu penible Genauigkeit") verstanden wissen,
dessen Exponate heute noch in einer Reihe von Museen, unter anderem in
Melbourne, Sydney und Nordamerika, zu sehen sind. Max Hundt urteilte
über Johannes Kaulfuß: „Er hätte die Zierde jedes Lehrstuhls einer
Universität sein können ..." Und weiter: „Wer Gelegenheit hatte, mit
diesem großartigen Menschen, Forscher und Kameraden besinnliche Stunden
im Gespräch zu verbringen, wird bestätigen, dass er zu den bedeutendsten
Söhnen dieser Stadt gehörte."
[Nach Ottmar Schmidt in (1), S. 235 bis 237]
Quellen
(1) O. Schmidt, Wegmarken. Chronik einer Region, Kulmbach 2000.
(2)W. Protzner, Ein Ausflug in lebendige Geschichte, Kleiner Museumsführer (Faltblatt), Stadt Kulmbach
o. J.
[=>
zurück zur Kaulfußsammlung]
[=> Neues Thema]
|
|
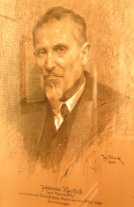 Abb. 1
Abb. 1
Johannes Kaulfuß (1859-1947)
Pastellzcichnung Joh.
Tillak 1930
 2
2
Eine beeindruckende Vielfalt von Formen und Farben
 Abb. 3
Abb. 3
Tropische Schmetterlinge
 Abb.
4 Abb.
4
 Abb. 5
Abb. 5
Vogelspinnen, Skorpione, Zikaden und Heuschrecken
 6
6
Ein immer noch stattlicher Rest der Kaulfußsammlung
 Abb. 7
Abb. 7
 Abb. 8
Abb. 8
 Abb. 9
Abb. 9
Ein wahrhaft 'gigantischer' Käfer
|
![]() nach
oben [home]
Fotos:
Dieter Schmudlach: 17.03.2008/03.03.2010
nach
oben [home]
Fotos:
Dieter Schmudlach: 17.03.2008/03.03.2010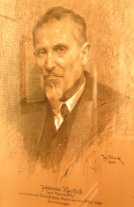


 Abb.
4
Abb.
4




